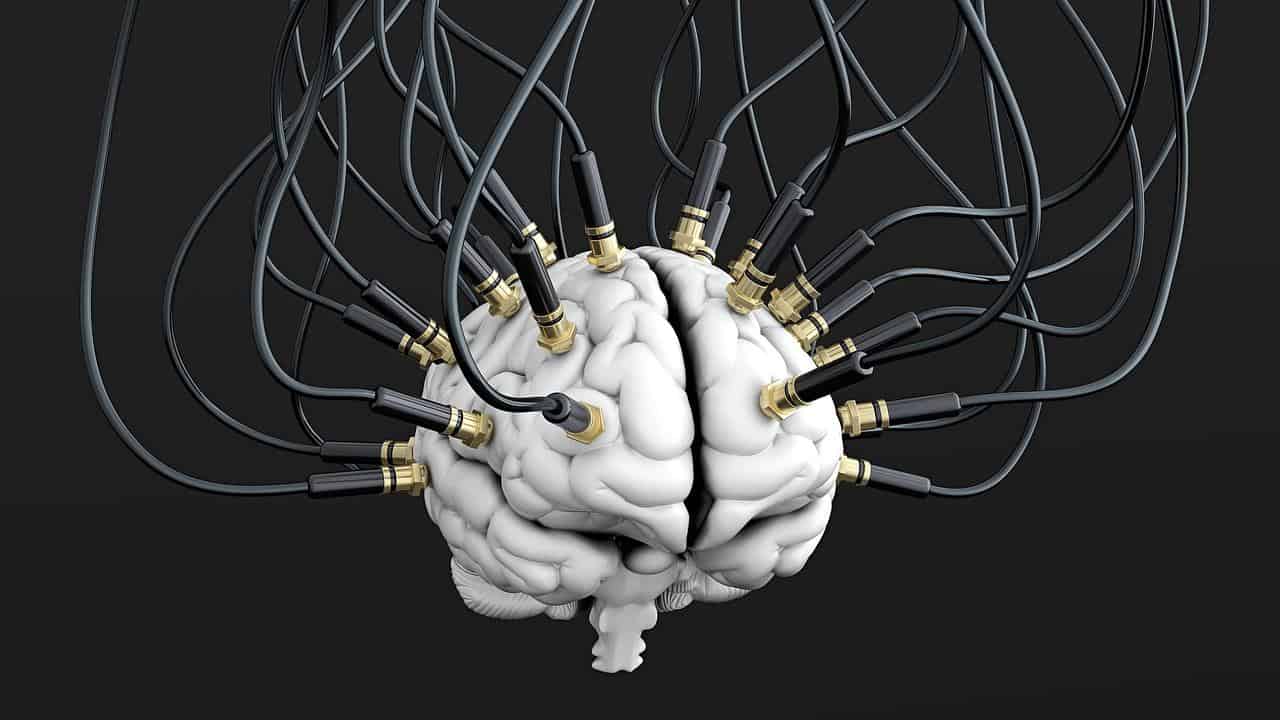Bericht vom Psychosomatischen Dienstags-Kolloquium „Körper – Seele – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg vom 15.05.18
Von Prof. Tilman Habermas: „Die Rolle des Zuhörers beim Erzählen: Eltern und Therapeuten“
Herr Habermas gehört der seltenen Spezies „Professor für Psychoanalyse“ an. Sein Vortrag soll allerdings weniger psychoanalytisch als vielmehr psychologischer Art sein. Er interessiert sich und forscht schon seit längerer Zeit über das Erzählen – insbesondere über Lebenserzählungen, mit deren Hilfe Menschen ihre Identität formen. Von der monologisierenden Form ist er inzwischen zur dialogischen fortgeschritten und nun forscht er seit neuestem über die Rolle des Zuhörers beim Erzählen.
Was ist eine Erzählung?
Herr Habermas stellt uns zunächst vor, was eine Erzählung ausmacht. Dazu erinnert er daran, dass Erzählungen etwas Alltägliches sind, dass sie ständig stattfinden und dabei auch verschiedene Funktionen erfüllen. Auf individueller Ebene bringt man seine Mitmenschen auf den neuesten Stand, was die eigenen Erlebnisse betrifft, sucht aber auch nach Teilhabe an den emotionalen Aspekten der Erzählung. Auf kollektiver Ebene geht es um kollektive Identitäten von Familiengeschichten, Firmengeschichten, bis hin zu nationalen Epen der Staatsgründung. Immer geht es dabei darum, eine gemeinsame Realität herzustellen. Aber Geschichten dienen auch der Unterhaltung, denn sie können die Zuhörer etwas lehren, können aber auch zu etwas verführen und von etwas überzeugen. Erzählungen dienen der Selbstdarstellung, sowie der Erklärung menschlichen Verhaltens, das sie rechtfertigen oder entschuldigen wollen.
Weiter besitzen Erzählungen eine innere Struktur, die einen strikten zeitlichen Ablauf aufweist, in dem nichts vertauscht werden darf. Außerdem gehört zu einer Erzählung eine Bewertung über das Erzählte. Erzählt werden in der Regel nur außergewöhnliche Vorkommnisse und zwar in folgender Reihenfolge. Zunächst kommt eine Ankündigung, dass nun etwas erzählt werde. Dann wird kurz der Hintergrund und der Kontext erläutert, darauf folgt die eigentliche Geschichte mit ihrer Komplikation. Weiter geht es mit den Handlungen, die daraufhin ausgeführt werden. Schließlich folgt das happy oder unhappy-end. Das Ende der Erzählung besteht dann meist aus „der Moral von der Geschichte“.
Die Rolle des Zuhörers
Welche Rolle spielen Zuhörer bei so einer Erzählung? Zunächst muss vereinbart werden, dass der/die Erzähler*in nun etwas erzählen darf. Der Erzähler darf nun seinerseits Interesse an seiner Erzählung erwarten. Dies wird durch Blickkontakt, Hmm-Lauten, Nicken und ähnliche Zeichen signalisiert. Zum Ende der Erzählung wird der/die Zuhörer*in einzelne Worte wiederholen, seine Bewertungen benennen (krass ey!) und evtl. mit einer eigenen, ähnlichen Geschichte aufwarten.
Eine spezielle Form der Erzählung ist die, des Sich-Anvertrauens mit einem Problem. Hier lässt sich ein Anteilnahme Muster erwarten. Die Zuhörer drücken aus, dass sie das Erzählte ebenfalls ungewöhnlich finden und dass sie dem Erzähler Glauben schenken. Sie bringen ihr Mitgefühl zum Ausdruck und explorieren die Erzählung weiter, sie trösten der Erzähler, zeigen sich solidarisch mit ihm/ihr und warten häufig mit Ratschlägen auf. Dabei gilt die Regel, dass je schwerwiegender das erzählte Ereignis war, sich die Zuhörer umso mehr zurückhalten.
Zuhörer gestalten Geschichten mit
Herr Habermas kommt nun zu seiner Kernthese, die lautet: „Zuhörende haben eine zwar wichtige, aber recht passive Rolle beim Erzählen. Es gibt jedoch Situationen, in denen sie eine wesentlich aktivere Rolle spielen. Und darunter sind sehr spezielle Situationen, in denen Zuhörende aktiv nicht nur die Geschichte mit-erzählen und verändern, sondern auch die Person des Erzählenden formen, indem sie aktiv zuhören und mit erzählen.“ Zwei solcher Situationen sind die Gespräche zwischen Eltern und ihren Kindern und die Situation von Therapeut und Patient. Beiden Fällen gemeinsam ist der Unterschied zwischen Sprecher/Hörer bezüglich der Autorität und der Kompetenz. Allerdings gibt es natürlich auch Unterschiede in den Situationen. Eltern haben einen Erziehungsauftrag, sie bringen Kindern bei, wie Erzählen funktioniert, wie die Erlebnisse zu verstehen sind und wie man richtig empfindet und reagiert. Therapeuten hingegen haben einen Therapieauftrag. Sie bringen Patienten bei, wie sie Erlebnisse und sich selbst verstehen können.
Eltern-Kind Gespräch
Ein kleiner Exkurs zur Eltern-Kind Situation verdeutlicht, das Vorschulkinder vor allem das Erzählen an sich erlernen, während Jugendliche beim Erzählen lernen, ihre Emotionen zu bewältigen. Das lässt sich anhand eines drei-phasigen Modells darstellen, auf dessen erster Stufe das Kind eine Fähigkeit noch nicht besitzt, aber einen fähigen Elternteil. Auf der zweiten Stufe übt das Kind die Fähigkeit in Zusammenarbeit mit dem Elter ein, um auf der dritten Stufe, die autonome Fähigkeit entwickelt hat.
Die Art und Weise, wie Eltern auf die Erzählungen der Vorschulkinder eingehen, hat durchaus Folgen für die Entwicklung der Erzählfähigkeit, die Gedächtnisleistung, die Fähigkeit andere Perspektiven einnehmen zu können und sogar die Bindungsqualität. Eltern können ihre kleinen Kinder durch Fragen unterstützen. Das geht mit geschlossenen Fragen, sog. W-Fragen oder mit offenen Fragen und durch die Auswertung des Erzählten.
Ab dem etwa neunten Lebensjahr können Kinder bereits recht gut erzählen. Trotzdem können Eltern auch hier noch hilfreich sein, indem sie vor allem dabei helfen, die emotionalen Aspekte des Erzählten zu integrieren.
Gefühle und Bedeutungen von und in Erzählungen
Es folgt ein Beispiel einer solchen Unterhaltung zwischen Mutter und Kind. Herr Habermas arbeitet daran heraus, dass die Mutter die zeitliche Perspektive erweitert, indem sie an ähnliche Situationen erinnert, dadurch die Gefühle verstärkt und einen Lerneffekt aus der Geschichte entstehen lässt. Die Mutter ergänzt und verändert auch die Motive der Beteiligten und stellt alternative Erklärungen zur Verfügung. Sie verallgemeinert die Situation und bietet einen Abstand zur Erfahrung. Auch die Umdeutung des Erlittenen wird aus der Passivität in die Aktivität uminterpretiert. Andere Möglichkeiten bestehen noch darin, die Persönlichkeit der Beteiligten als Erklärung anzunehmen. Das wären z.B. biografische Empfindlichkeiten, die eine Rolle spielen könnten und überhaupt kann die Persönlichkeiten durch biografische Erfahrungen erklärt werden.
Insgesamt geht die Mutter weniger auf die Ereignisse und Handlungen ein, als vielmehr auf die Motive und die Bewertungen, indem sie darauf abhebt, warum die Beteiltigten so gehandelt haben und wie das zu bewerten ist?
Therapeut-Patient Gespräch
Ähnlich den Eltern haben Therapeuten „die Aufgabe, die Fähigkeiten der Klienten zu verbessern, insbesondere ihre Fähigkeiten zur Introspektion, Reflexion und Bewältigung von kritischen Erlebnissen.“
Anders als Eltern haben Therapeut*innen die erzählten Ereignisse nicht miterlebt Sie haben acuh keine erzieherische Aufgabe. In der Regel dürfen sie (kaum) werten, denn sie sollen auf das Erleben des Patienten fokussieren, allerdings dürfen sie die Motive in Frage stellen und deuten.
Herr Habermas geht nun der Frage nach, welche Rolle das Erzählen in psychodynamischen Therapien spielt. Zunächst stellt er fest, dass es nicht so sehr darum geht, falsche Geschichten zu zerlegen oder das Patient*innen nur frei assoziieren. So gut wie immer finden die Mitteilungen der Klienten eine Erzählform für ihre Anliegen. Dazu stellt Herr Habermas folgende These auf: „Psychodynamische Psychotherapie lässt sich beschreiben als Arbeit am Erzählen, mit dem Ziel, dass möglichst alle relevanten Perspektiven eingeschlossen werden.“
Techniken therapeutischen Zuhörens
Zum Beleg der These will er beschreiben, wie Therapeuten aktiv zuhörend die Erzählungen vervollständigen. Dazu erläutert er vorab die klassischen Interventionen der psychoanalytischen Ichpsychologie. Diese bestehen aus Klärung der unklaren und fehlenden Teile, gefolgt vom Konfrontieren mit Fehlendem, mit Inkonsistentem, mit Auffälligkeiten und dem Deuten von z.B. Ängsten und abgewehrten Motiven, sowie der Emotionen. Wie beziehen sich nun diese Interventionen auf Geschichten?
Dazu bekommen wir noch zwei Gesprächsausschnitte vorgeführt, in denen die Anwendung der Interventionen die Geschichten vervollständigen, und dadurch die Emotionen und Motive geklärt werden. Daraus leitet Herr Habermas ab, auf welche Teile der Geschichte sich Therapeuten bevorzugt beziehen. Es sind verschiedene Teile, die aber immer mit Emotionen zu tun haben. Es geht dabei um Emotionen, die ein Motiv für Abwehr sein können.
Und die Moral von der Geschichte?
„Erzählungen sind ein zentrales Medium um Handlungen und Emotionen von Menschen zu verstehen.
Deshalb ist das Erzählen mit Eltern so wichtig für das Erlernen sozio-kognitiver und sozio-emotionaler Fähigkeit
Deshalb ist das Erzählen mit Therapeuten so wichtig für das Verstehen neurotischer Verzerrungen und Unglücks.“