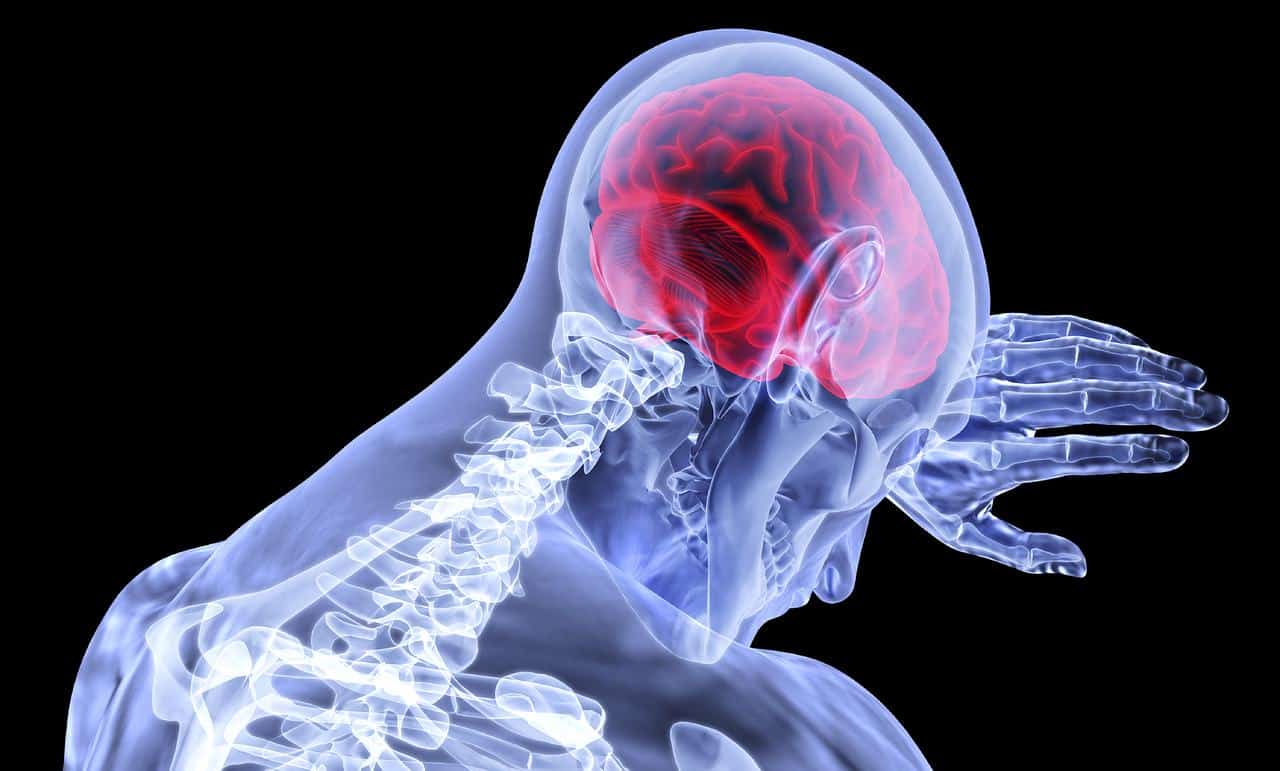„Träumen Mit Körper, Seele und Geist“ Bericht vom Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg, Vortrag von: Verena Kast, Prof. Dr. phil., Psychologin, Universität Zürich, CH
Zu Gast ist heute Verena Kast, die jungianische Analytikerin und Autorin vieler Werke über Träume. Träume sind auch heute ihr Thema – Träume mit Körper, Seele und Geist.
Einleitung
Wir erfahren zu Beginn, dass ein siebzigjähriger Mensch bereits sieben Jahre seines Lebens geträumt hat. Dabei sind nicht einmal die Tagträume eingerechnet. Dabei stehen heute die Tagträume im Mittelpunkt der Traumforschung. Ihr Fazit: Träume sind wichtig, sie müssen etwas bedeuten und das war schon bei Freud und Jung so und so ist es heute noch.
Träume geben den Träumer*innen Anregungen, „wollen“ womöglich sogar anregen. Wenn ich meine Träume verstehen will, dann ist es wichtig, sie bei mir zu tragen, mit ihnen und über sie zu meditieren, mit ihnen zu imaginieren, um ihre Anregungen zu entschlüsseln.
Nach C.G. Jung sind Träume Zielvorstellungen aus dem Unbewussten und sie spielen in der Psychotherapie eine wichtige Rolle, z.B. der Initialtraum, der häufig kurz nach Beginn einer Psychotherapie geträumt wird. Er kann viele Informationen über die Themen des Patienten enthalten, aber auch, wie der Patient die Beziehung zum Therapeuten erlebt, denn: „Träume werden zwischen Menschen geträumt.“ So C.G. Jung.
Wozu sind Träume gut?
Frau Kast stellt uns die Struktur ihres Vortrags mit Hilfe der Schlussfolie vor. Wozu also sind Träume überhaupt gut? Sie regulieren Emotionen, regen zu Konfliktlösungen an, machen Verdrängtes sichtbar und sie erinnern und planen. Darüber hinaus bieten sie einen erweiterten Imaginationsraum, in dem Kreativität entwickelt und neue Möglichkeiten entdeckt werden können.
Ein Traum ist erst ein Traum, wenn wir erwachen und ebenso ist ein Tagtraum erst dann ein Tagtraum, wenn wir uns wieder bewusst werden. Das bedeutet, dass Träume den ganzen Menschen erfassen und dass Träume mit allen Sinnen erlebt werden.
Wir erfahren, dass es auch heutzutage noch eine intensive Traumforschung gibt, und lernen nach und nach neuere und neueste Befunde der Traumforschung kennen. Z. B. dass es eine „Traumbank“ gibt, die vom Traumforscher William Domhoff betrieben wird. Auf den Konten dieser Bank liegen über 100.000 Träume für Forscher*innen zur Verfügung. Herr Domhoff vertritt die These, dass Träumen eine intensivierte Form von wachem, spontanen Denken ist. Dazu zählt er auch Gedankenwandern und v.a. Tagträumen.
Um zum nächsten Punkt überzuleiten, schildert uns Frau Kast ihre Motive, bzw. ihr Interesse an Träumen. Sie ist fasziniert von der Kreativität der Träume, von den Verbindungen der Träume zur Persönlichkeit der Träumenden und auch über die Hinweise zu psychischen Krankheiten, die Träume liefern können.
Selbstgenerierte Gedanken
Die aktuelle Traumforschung versteht unter Träumen „selbstgenerierte Gedanken“ – das sind quasi Gedanken, die sich selbst denken, also nicht willentlich angestoßen oder gefasst werden, sondern sich unabhängig von der aktuellen Situation von selbst entwickeln. Diese Art des Denkens ist weit verbreitet, das legen zumindest aktuelle Forschungsergebnisse nahe. Dazu wurden viele Proband*innen immer wieder nach ihren aktuellen Gedanken befragt. Die Inhalte der Gedanken drehten sich um Erinnerungen, Pläne, Tagträume, Fantasien, soziale Interaktionen oder Ruminieren (Ruminieren bezeichnet das gedankliche Kreisen um eine Selbstzuschreibung, z.B. Ich komme immer zu kurz).
Diese Art der Geistestätigkeit kann also vom Unbewussten angestoßen, aber auch absichtlich ergriffen werden. Es ist möglich, sich vorzunehmen, nun einen schönen, angenehmen Tagtraum zu beginnen.
Eine weitere Erkenntnis der aktuellen Forschung besagt, dass Nacht- und Tagtraum in einem gemeinsamen Kontinuum liegen. Es ist beiden gemeinsam, dass die Aufmerksamkeit für die Umwelt vermindert ist, was im Schlaf natürlich umfangreicher gegeben ist. Beides sind Prozesse eines selbstgenerierten Denkens, das sich andauernd unter der Schwelle des Bewusstseins abspielt. Diese selbstgenerierten Gedanken sind emotional, können beschwingend oder störend sein und sie ringen um die Aufmerksamkeit des Bewusstseins.
Nicht nur an dieser Stelle weist Frau Kast darauf hin, dass diese Ergebnisse weitgehend der Modellbildung von C.G. Jung entsprechen.
Spezifisches zum Tagtraum
Auch Tagträume bedienen sich des gesamten Sinnesspektrums. Sie sind visuell, auditorisch, somatosensorisch und mindestens zwei Drittel der generierten Bilder sind stark emotional, bzw. zeigen etwas darüber, was den Träumer emotional beschäftigt.
Es ist nicht ganz einfach zu unterscheiden, an welchen Stellen die Träume absichtlich geträumt werden oder ob sie sich unwillkürlich einstellen. Gerade für die imaginierten sozialen Interaktionen scheint es eine Mischung von beidem zu sein und ebenso bei Erinnerungen oder Zukunftsplanungen. Es zeigt sich jedoch, dass der affektive Zustand eines Menschen von der affektiven Qualität seiner Tagträume beeinflusst ist.
Eine weitere Domäne der Tagträume ist die Imagination von Gedanken und Absichten anderer Menschen. Diese Beschäftigung ähnelt sehr dem, was in der Psychologie die „Theory of Mind“ genannt wird.
Ein sehr wertvoller Aspekt stellt die Vorfreude auf ein zukünftiges Ereignis dar. Diese sei eine kraftvolle Freude und Frau Kasts Empfehlung lautet, sie zu genießen, denn selbst wenn das Ereignis nicht so toll wie erwartet ausfällt, so hat man wenigstens die Vorfreude genossen.
Bezogen auf den Körper sind Träume und Tagträume auch verkörperte Simulationen, die sich auf die reale Welt beziehen. In diesem Modus können Lösungen erprobt werden und auch neue Lösungswege gefunden werden.
Komplex und Traum
C.G. Jung hat viel zum Thema der Komplexe geforscht und festgestellt, dass Komplexe Träume verursachen und Träume Komplexe in einen Kontext setzen und sie auf diese Art verarbeiten. Als weiteren Aspekt fand er heraus, dass Träume die bewusste, komplexbelastete Haltung kompensieren können. Dazu werden in den Träumen die Komplexe personifiziert und das geht leichter, wenn kein hemmendes Bewusstsein das erschwert.
Komplexe haben auch viel mit Affekten zu tun. Affekte verursachen Komplexe und Komplexe beeinflussen Affekte. Jung hat das insbesondere mit seinen Assoziationsexperimenten erforscht. Stark emotionsgeladene Begriffe, wie sie bei Komplexen auftreten, verändern die Reaktionszeit der Assoziation oder sie führen zu Ausweichverhalten. Die bewussten Absichten der Getesteten weichen unbeabsichtigten Fehlern.
Zur Entstehung des Komplexes mutmaßte Jung, dass er aus dem Zusammenstoß eine Anpassungsforderung und der Unmöglichkeit des Subjekts, dieser Anforderung zu genügen, entspringt. Auch dieses Modell ähnelt sehr den aktuellen Vorstellungen über konflikthafte Beziehungserfahrungen, die sehr emotional und wiederholt erlebt wurden. In diesen Erfahrungen geht es um zentrale Bedürfnisse, die frustriert wurden. Sie werden in einer Szene verdichtet, in der Regel verdrängt und häufig entwickeln die Betroffenen dann eine kompensierende Haltung – z.B. kann der frustrierte Wunsch nach Anerkennung mit dem Gefühl des Schams, durch eine perfektionistische Haltung kompensiert werden.
Zur Verdeutlichung dieser Zusammenhänge berichtet uns Frau Kast von einem Fallbeispiel, das tatsächlich sehr anschaulich zeigt, wie aus einem Traum und den dazugehörigen Assoziationen und Imaginationen wichtige Einsichten für das Leben der Träumerin entstehen können.
Neue Traumforschung
Wir erfahren nun noch einige Ergebnisse der aktuellen Traumforschung. So berichten einige Befragte von Träumen, in denen sie häufig Ängste erleben. Überraschenderweise sind diese Menschen aber im Wachzustand besser imstande, mit ihren Ängsten umzugehen – sie üben gewissermaßen im Traum, was sie mit ihren Ängsten aktiv tun können.
Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die im Wachzustand negative Gedanken unterdrücken. Sie leiden häufig verstärkt unter Schlafproblemen, verspüren mehr Ängste, neigen zu Depressionen und haben Stress. Ihnen könnte es helfen, sich mit ihren Träumen zu beschäftigen, gewissermaßen ihren Ängsten ins Gesicht zu sehen und dadurch Wege zu finden, wie sie ihre Probleme bewältigen können.
Vorläufiges Fazit
Frau Kast fasst zusammen: Träume und Tagträume stellen Erfahrungen, Konflikte, bzw. Probleme in einen erweiterten Kontext. Sie generieren Fragen aus einer emotionalen Perspektive. Sie können mit Imaginationen ausgeweitet und in eine Erzählstruktur überführt werden. Diese Betrachtung führt auch zu methodischen Konsequenzen. Die Träumer*innen sollen ihre Träume selbst erzählen, sie sich bildhaft vorstellen und dabei alle Kanäle der Wahrnehmung nutzen, sich trauen, den Traum auch emotional zu erzählen. Die Zuhörerin geht mit, so gut sie kann, lässt sich auf die Erzählung, die Bilder und Sensationen ein. Sie kann ihre eigenen Imaginationen spielerisch einbringen und so versuchen eine Brücke zwischen den Träumen und den Alltagsherausforderungen zu schlagen.
Um das zu illustrieren, berichtet Frau Kast noch von der Arbeit an einem Alptraum. Sehr eindrücklich schildert sie uns, wie sie sich auf die Schreckensbilder dieses Traums einlässt, mitfühlt und den Schrecken mit der Patientin teilt. Verschiedene Fragen zum Traum führen nach und nach zu wichtigen Einsichten, die dann auch zu einer konkreten Strategie für den Umgang mit den Ängsten der Träumerin führt.
Ein sehr informativer Vortrag, den Sie hier selbst hören können.