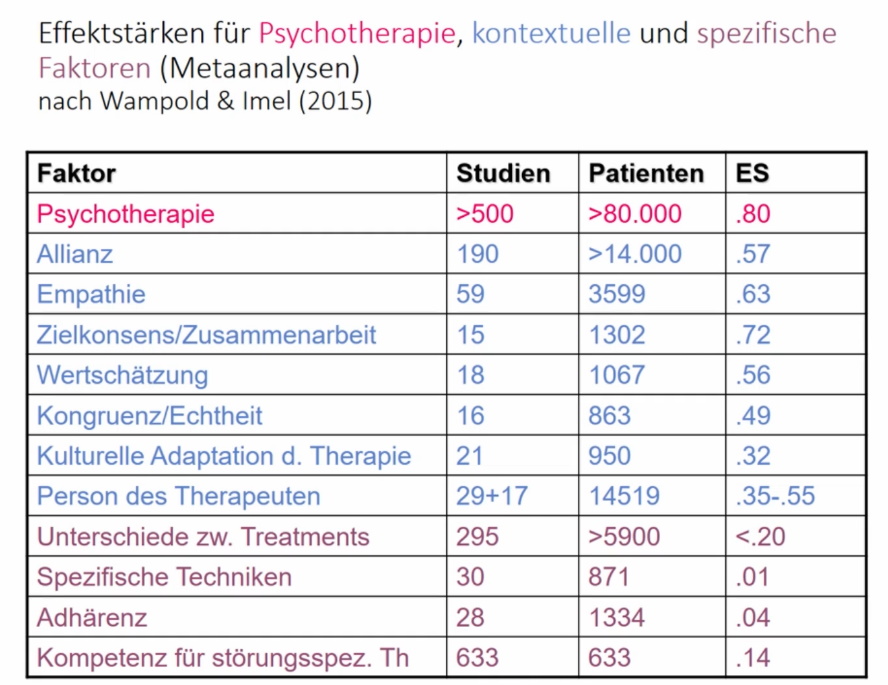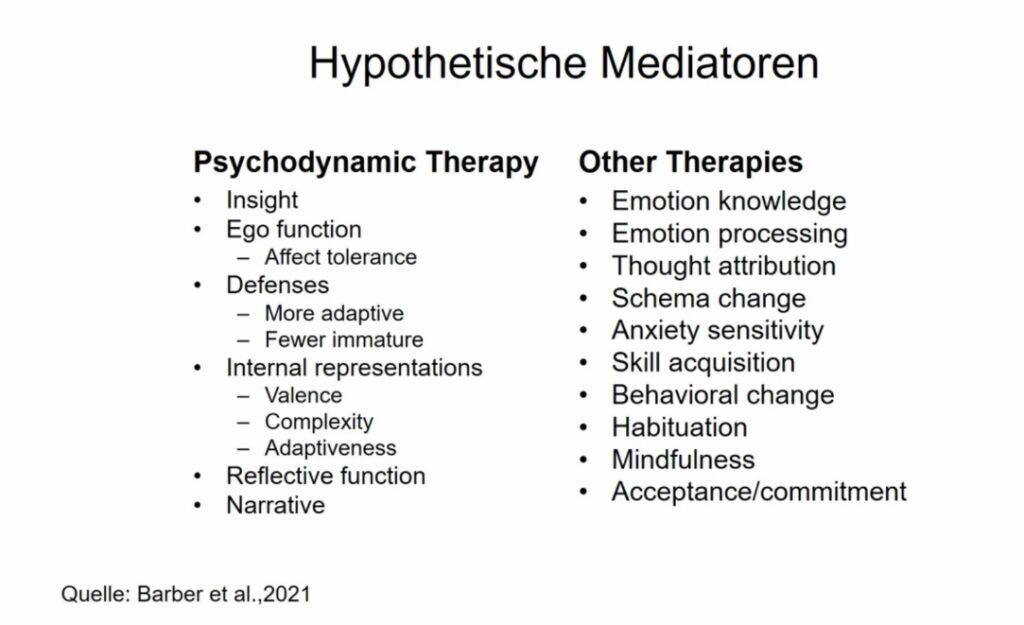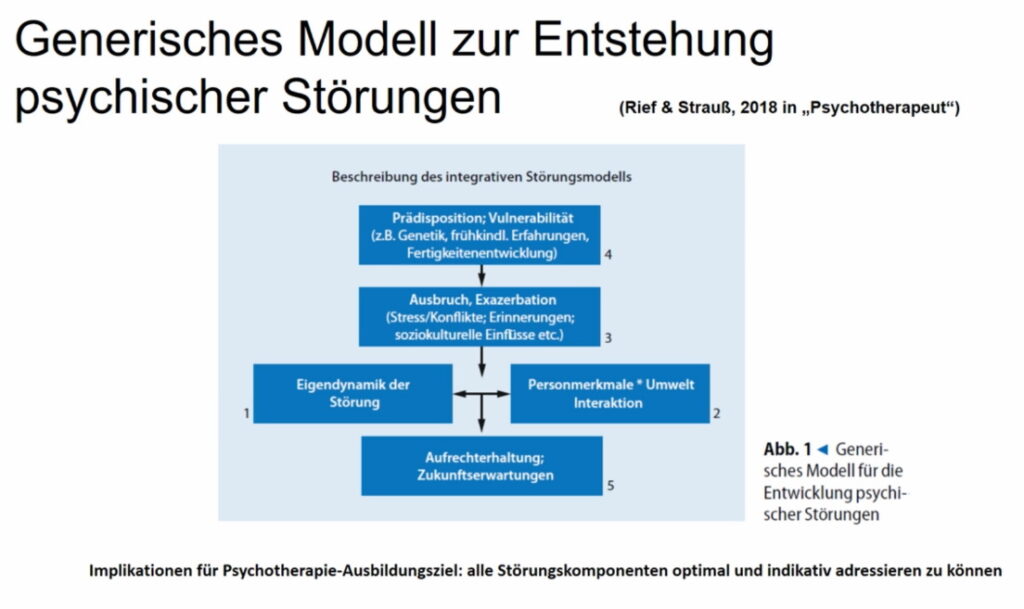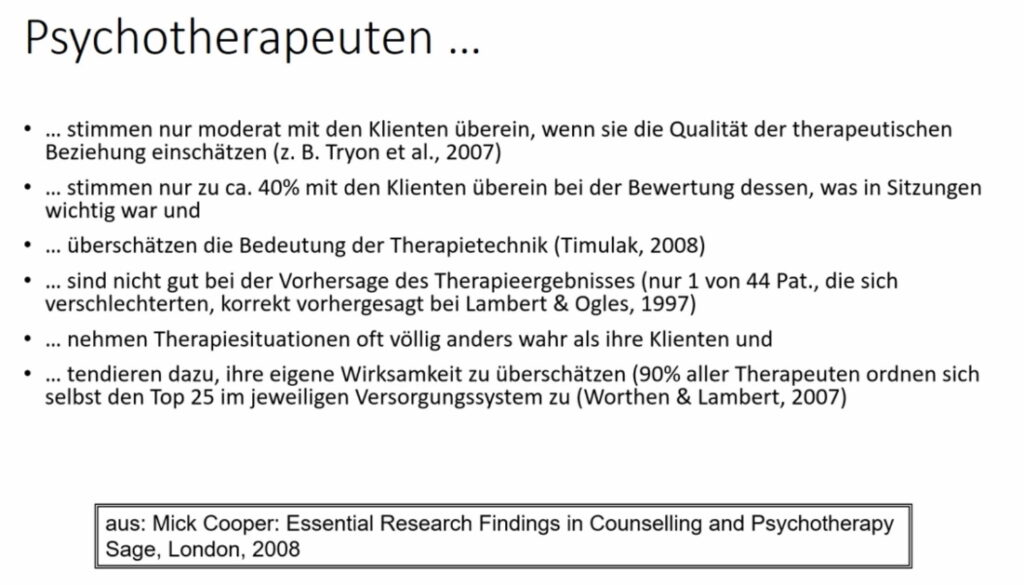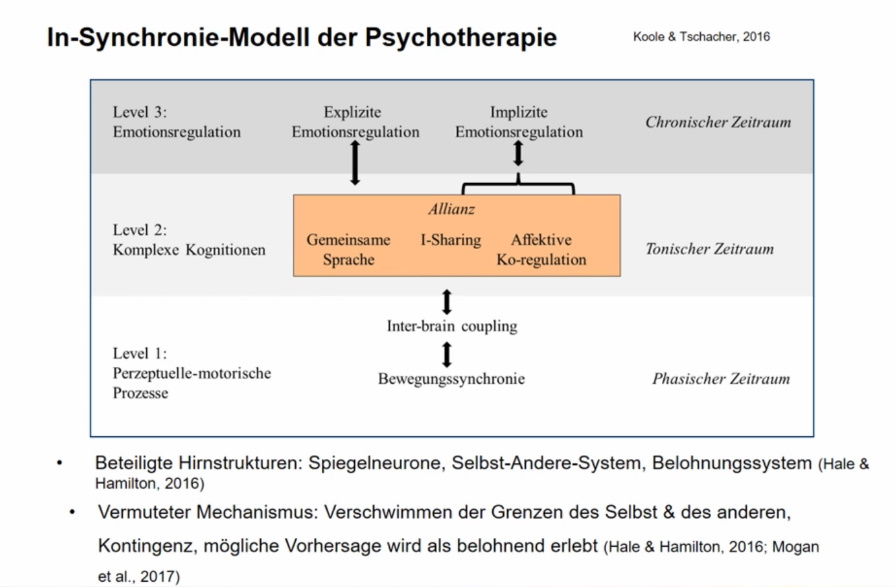Bericht vom 06.12.22 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Prof. Dr. Dr. Thomas Fuchs, Leiter der Sektion „Phänomenologische Psychopathologie und Psychotherapie“ der Klinik für Allgemeine Psychiatrie des Universitätsklinikums Heidelberg. Sein Vortrag trägt den Titel: Leibliche Präsenz und Virtualität
Einleitung
Thomas Fuchs erzählt zur Einführung von dem Science-Fiction Roman „The machine stopps“, in dem eine Menschheit beschrieben wird, wie sie in dem Film „Matrix“ dann gezeigt wurde. Die Menschen leben völlig voneinander isoliert in künstlichen Blasen – ihre gesamte Wahrnehmung ist virtuell vermittelt. Als die Maschine kaputtgeht sterben die Menschen, denn sie haben verlernt, selbst etwas zu tun.
Virtualität sei ein zentrales Thema des 21ten Jahrhunderts, so Herr Fuchs und sie breite sich ja auch immer weiter aus. Kaum ein Arbeitsplatz, der nicht davon betroffen ist. Das Virtuelle durchdringt mehr und mehr die gesamte Lebenswelt.
Neurokonstruktivismus
Dazu passt auch der sog. Neurokonstruktivismus. In dieser Anschauung wird die Welt selbst zum Konstrukt. Die Menschen haben dieser Sichtweise nach nur einen Ego-Tunnel oder leben in einer Art Kopf-Kino – es gibt keinen echten Zugang zur Welt. So schreibt der Neurophilosoph Thomas Metzinger: „Unser Gehirn erzeugt eine Simulation der Welt, die so perfekt ist, dass wir sie nicht als ein Bild in unserem eigenen Geist erkennen können […] Wir stehen also nicht in direktem Kontakt mit der äußeren Wirklichkeit oder mit uns selbst. Wir leben unser bewusstes Leben im Ego-Tunnel.“
Neurokonstruktivismus und der Andere
Auch der Weg zum Mitmenschen ist uns verstellt. Wir brauchen eine Theory of Mind, eine Art Simulation oder Mind-Reading, um uns ein Modell des anderen Menschen herzustellen.
Neurokonstruktivismus und Virtualität
In der Anschauung des Neurokonstruktivismus verschwimmt und verschwindet der Unterschied zwischen Bild und Original bzw. gibt es am Ende nur noch Bilder und die Welt droht zu verschwinden. Es entsteht so etwas wie eine „Kultur der Simulation“.
Welche Auswirkungen hat das auf die Fähigkeit der Empathie? Empathie kann auch ins Fiktive und Illusionäre übergreifen, denn wir sind empathisch verbunden mit unseren Fantasien und Vorstellungen. Je weiter die Empathie sich jedoch von der leiblichen Erfahrung des anderen abkoppelt, desto mehr erfasst sie nur noch sein Bild, einen Schein.
Überblick
Stufen der Empathie
Empathie und Virtualität
Virtualisierung der Lebenswelt
Stufen der Empathie
Seit der Einführung des Begriffs Ende des 19ten Jahrhunderts, gibt es Versuche, die Empathie zu definieren. Dazu wurde die „Theory of Mind“ herangezogen und eine Simulationstheorie entwickelt, aber Herr Fuchs möchte lieber auf die „Theorie der direkten sozialen Wahrnehmung“, auch „Theorie der leiblichen Kommunikation“ genannt, zurückgreifen.
Aus diesem Verständnis ergeben sich die drei Stufen von Empathie:
- die „primäre, verkörperte Empathie“
- die „sekundäre kognitive Empathie“
- die„fiktionale oder projektive Empathie“
primäre Empathie
Wenn wir uns einem wütenden Menschen gegenübersehen, wird uns dessen Zustand sofort bewusst. Ein Philosoph der Philosophischen Anthropologie, Max Scheler schrieb dazu: „Wir nehmen im Lächeln des anderen unmittelbar die Freude, in seinen Tränen das Leid, in seinem Erröten, die Scham wahr.“ Menschen erkennen einander als physio-psychische Wesen an.
Aber wie kann das geschehen, ohne Simulation bzw. Konstruktion? Indem wir leiblich-körperlich in Resonanz kommen. Wir spüren den jeweils anderen am eigenen Leib, sein emotionaler Ausdruck berührt und bewegt uns, so dass wir leiblich antworten und damit in eine leiblich-affektive Kommunikation einsteigen.
sekundäre Empathie
Dieses einfühlende Verstehen können wir nun auch noch ausweiten, indem wir uns vorzustellen versuchen, weshalb der andere in so einem Zustand ist. Wir vollziehen eine Perspektivübernahme, an der auch ein imaginärer Anteil mitspielt – eine Als-Ob Position.
fiktionale Empathie
Von der impliziten zur expliziten Empathie ist es nur noch ein weiterer Schritt zur fiktionalen Empathie, wenn wir z.B. mit unseren Lieblingshelden in Büchern oder Filmen mitfiebern. Es ist sogar möglich, Empathie für völlig abstrakte geometrische Figuren zu entwickeln, wenn diese eine kleine Geschichte darstellen, die Anlass zu Gefühlen gibt.
Die Als-Ob Spiele sind ihrerseits eine Art Quelle der menschlichen Kultur. Sie ermöglichen uns Rollenspiele, ein Fantasiebewusstsein u.v.m.
Wenn die Fähigkeit zum Als-Ob verloren geht, wir also den Schein nicht mehr vom Original unterscheiden können, werden sich vermutlich Schwierigkeiten einstellen. Der Film „Her“, in dem sich ein Mann in ein Computerprogramm verliebt, dient Herrn Fuchs als Beispiel für dieses Phänomen.
Das hat durchaus Relevanz für die Psychotherapie, denn es gibt bereits einige Programme, die den/die Therapeut*in ersetzen sollen. Eine Studie dazu hat ergeben, dass die Nutzer*innen, obwohl sie wussten, dass sie es mit einer KI zu tun hatten, das Gefühl entwickelten, von ihrer KI verstanden und sogar gemocht zu werden. Herr Fuchs nennt dieses Phänomen: „Digitalen Animismus“.
Zwischen Resümee: Polarität der Empathie
Empathie weist also verschiedene Grade an Körperlichkeit auf – von der zwischenleiblichen zur kognitiven zur fiktionalen Empathie als ein Prozess von zunehmender Immersion (eintauchen in fiktive Welten).

In der leiblichen Kommunikation sind wir immer wieder mit der Widerständigkeit des anderen konfrontiert – Phasen von Resonanz wechseln mit solchen von Dissonanz. Das führt den Vortragenden zur:
Zusammenfassung: Polarität der Empathie
Dazu hören wir zwei Zitate von Emanuel Levinas (Philosoph):
„Intersubjektive Erfahrung beruht darauf, dass das Gesicht des Anderen immer ein Moment des Fremden und unverfügbaren enthält.“
Und:
„Personen werden füreinander wirklich, insofern sie sich gegenseitig als Wesen erkennen, die immer jenseits dessen bleiben, als was sie sich zeigen.“
Diese Art von Begegnung kann sich fiktional fantastisch ausschmücken. Je ferner wir dem Leib des anderen sind, desto mehr blühen die Projektionen.
Virtualisierung der Lebenswelt
Die Tendenz zur Virtualisierung entkoppelt die Menschen von ihrer unmittelbar zwischenleiblichen Erfahrung und führt im Weiteren zu einem gewissen „Disembodiment“. Dafür hat Philosoph Günter Anders bereits den Begriff der Phantomisierung entwickelt. Er meinte damit die Tendenz zur Aufhebung der Differenz von Sein und Schein.
Phantomisierung
Phantomisierung bedeutet auch, dass die Bilder Massenmedien uns die Realität vorspiegeln. In den Worten von Anders: „Die Welt unter ihrem Bild zum Verschwinden bringen.“ Die Welt wird von Simulacren bewohnt, Phantome, die Realität vorspiegeln, so tun, als seien sie genau in diesem Moment präsent.
Damit verschwindet auch der Als-Ob Charakter des Bildes und begünstigt so, dass die Realität mehr und mehr in Vergessenheit gerät. Auch hier hat Anders einen schönen Begriff: „Medialer Idealismus“ Die Welt als Schauspiel – ähnlich dem Neurokonstruktivismus.
Die Technik schaffte es nun sogar, dass wir körperlich mit den Maschinen interagieren z. B. am Touch Screen. Diese Interaktionen im Cyberspace im Metaversum führt zu einer „Einleibung“ des virtuellen Raums. Dort, in der virtuellen Realität, gibt es keine Widerstände oder allenfalls solche, die zu überwinden sind – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Der widerständige Körper aus Fleisch und Blut wird verdrängt zugunsten eines rein funktionalen Körpers, der an eine virtuelle Maschine angeschlossen ist.
Entkörperung der Kommunikation
Auch das Kommunikationsverhalten erfährt eine tiefgreifende Wandlung. Immer mehr Menschen leben in virtuellen Blasen und pflegen dort eine Scheinpräsenz, in der sie anderen Scheinpräsenzen begegnen. Andere werden zu Schnittstellen ohne leibliche Verankerung, ohne zwischenleibliche Resonanz. Die Kontakte werden zahlreicher aber qualitativ ärmer, denn bei diesen Treffen kommt es eher zu Projektionen, als zu interaffektiven Begegnungen.
Die Soziologin Eva Illouz schreibt dazu:
„Fiktionale Emotionen können denselben kognitiven Inhalt haben wie reale Emotionen, aber sie sind selbstreferentielle: das heißt, sie beziehen sich zurück auf das Selbst und sind nicht Teil einer laufenden und dynamischen Interaktion mit einem anderen.“
Und:
„Der imaginative Stil, der sich in und durch Internet-Kontaktbörsen bildet, [muss] vor dem Hintergrund einer Technologie verstanden werden, die Begegnungen entkörperlicht und textualisiert […] Die so hergestellte Intimität beruht auf keiner Erfahrung und ist nicht körperlich grundiert.“
Im Online-Dating gehen die kleinen Schritte der allmählichen Annäherung verloren. Es entsteht so etwas wie eine Pseudo-Intimität, wobei der jeweils Andere überwiegend eine Projektionsfläche darstellt.
Günter Anders hat diese Entwicklung auf den Begriff des „Masseneremiten“ gebracht. Dieser möchte der Welt nicht entsagen, sondern ja keinen Brocken der Welt versäumen.
Resümee
Was also bringen diese Entwicklungen mit sich? Eine Annahme ist, dass sich die zwischenmenschlichen Beziehungen verändern werden, denn:
„Wenn so viel Zeit mit online- statt mit realen Interaktionen verbracht wird, könnte sich eine interpersonelle Dynamik wie die Empathie sicher verändern. So ist es womöglich leichter, Freundschaften und Beziehungen online zu etablieren, doch diese Fähigkeiten werden sich nicht in reibungslose soziale Beziehungen im wirklichen Leben übertragen lassen.“
Studien, welche die Veränderungen durch die Virtualität erforschen, kommen zu dem beunruhigenden Ergebnis, dass innerhalb weniger Jahre die Empathiefähigkeit junger Menschen teilweise erheblich (bis zu 40%) abgenommen hat.
Der Konstruktivismus ist eine Perspektive, die genau zu dieser Zeit passt. Er entspricht einer Kulturentwicklung, in der sich die Unterscheidungen zwischen Bild und Original, Schein und Sein, Virtualität und Realität zunehmend nivellieren.
Die Korrektur von Illusionen und Projektionen kann nur durch die aktive Auseinandersetzung mit der Welt und durch die Begegnung mit anderen erfolgen. Das letzte Kriterium für die Wirklichkeit ist der Widerstand und das Widerfahrnis: das, was uns zustößt, was wir nicht berechnen können.
Die Gegenwart überflutet uns mit Bildern und diese sind im besonderen Maße geeignet, unsere Imagination anzufachen. Gleichzeitig hypnotisieren sie uns und überrumpeln sie unsere Wahrnehmung.
Herr Fuchs plädiert dafür, dass wir lernen sollen, diese Flut einzudämmen und stattdessen wieder zu sinnlichen Erfahrungen und leiblich gegenwärtigen Begegnungen zurückfinden.
Martin Buber war der Ansicht, dass alles wirklich menschliche Leben, Begegnung sei. Herr Fuchs bringt das auf die folgende Schlussformel:
Nur der andere ist ein Sein jenseits des bloßen ‚für mich‘, jenseits des medialen Idealismus oder der neurokonstruktivistischen Innenwelt, aus der wir nie hinausgelangen.
Einzig der andere befreit mich auch aus dem Käfig meiner Vorstellungen und Projektionen, in dem ich immer nur mir selbst begegne.
Ausschließlich wenn andere für uns in konkreter Begegnung wirklich werden, werden wir auch uns selbst wirklich.
Hier geht es zum Vortrag