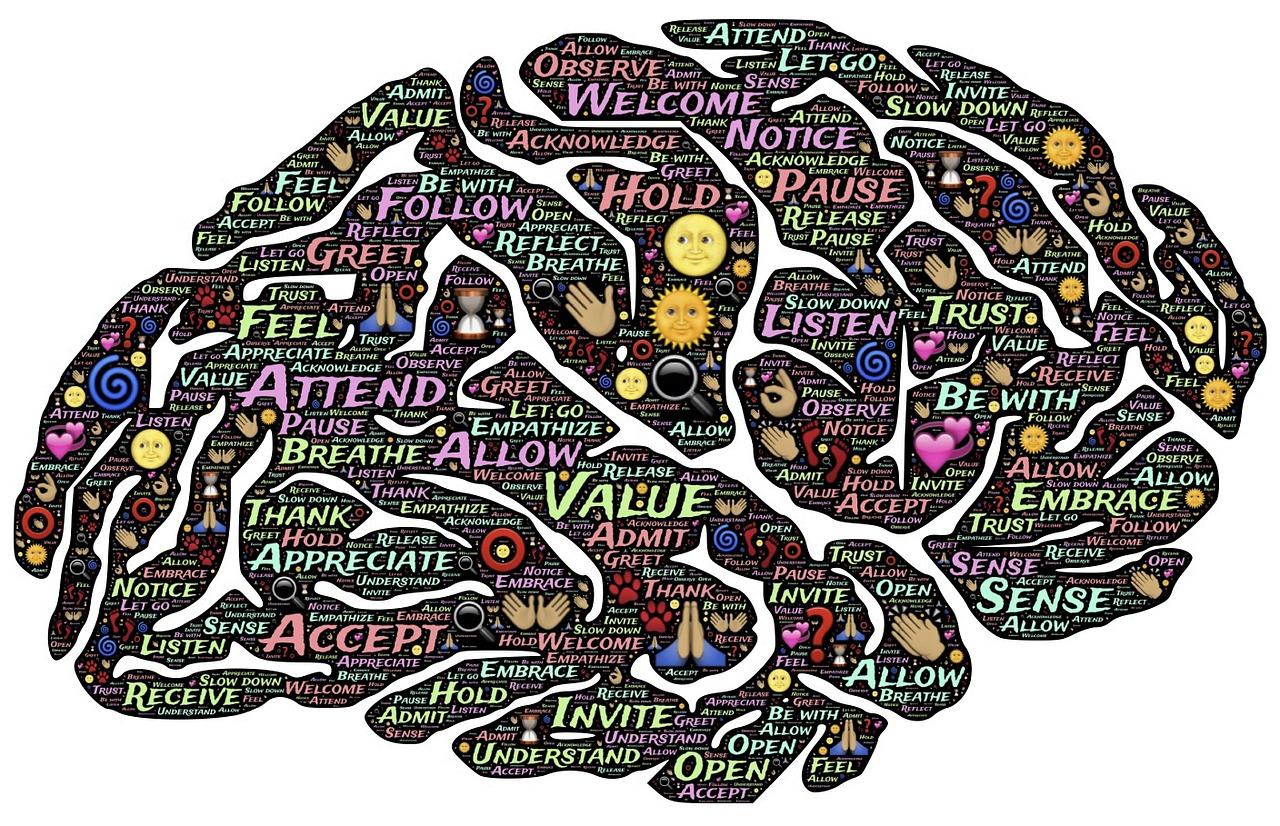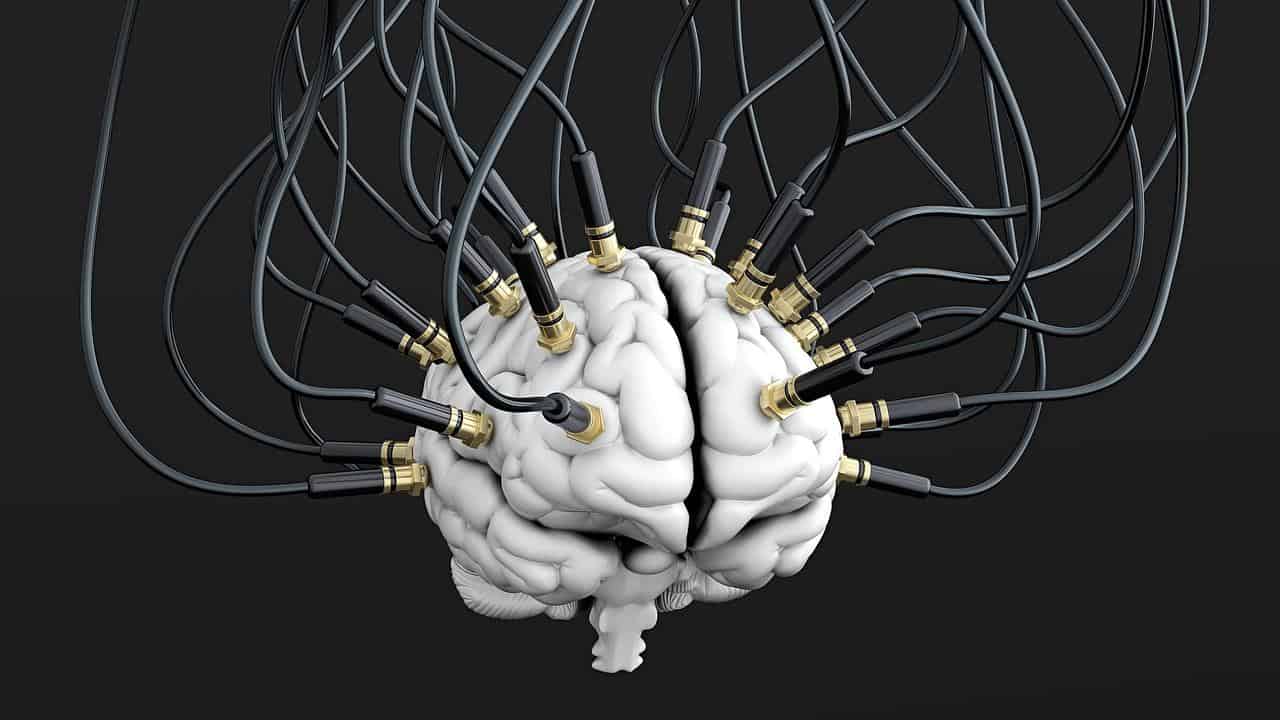Bericht vom 31.05.22 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Dr. Corina Aguilar-Raab: „Achtsamkeits-, Mitgefühls- und Mediationsbasierte Interventionen in der Psychotherapie“
Frau Aguilar-Raab forscht an und arbeitet mit den Themen, die sie uns in ihrem Vortrag vorstellen möchte. Zur Einführung bietet sie eine geführte Meditation an.
Auf der Basis dieser Erfahrung möchte sie uns darauf hinweisen, dass die innere Haltung mitentscheidet, wie ich eine Situation bewerte. Insgesamt sei das Feld der Meditationsbasierten Interventionen viel zu groß, um es in der Kürze der Zeit zu erläutern. Sie möchte uns vermitteln, was sich hinter Achtsamkeitsbasierten Interventionen verbirgt und auch etwas zur Wirksamkeit dieser Methoden.
Überblick:
Allgemeine Einführung: Meditationsbasierte Interventionen im klinischen Bereich
Achtsamkeitsbasierte Interventionen
Mitgefühlsbasierte Interventionen
Zusammenfassung, Perspektiven und Diskussion
Allgemeine Einführung
Wir sehen zunächst eine Folie mit der Überschrift: Kontemplative Praktiken im klinischen Kontext. Darunter finden sich die zu hinterfragenden Themen:
Entspannung vs. Kultivierung von sozio-emotionalen (ethischen) Aspekte als übende Verfahren
Körpereinbezug
Säkularität – Zielhorizont
Methode – Zustand
Transdiagnostik
Schulen-übergreifend
Beziehung
Patient*innen
Therapeut*innen
Patient*innen und Therapeut*innen
Psychotherapie: Outcome Prozess
Es geht im klinischen Setting nicht um Wohlbefinden und/oder Entspannung, obwohl sich beide Befindlichkeiten häufig einstellen. Es geht auch nicht darum, irgendwelche spirituellen oder religiösen Ideen anzuhängen, sondern eher darum, innere Qualitäten zu pflegen, seine Persönlichkeitseigenschaften kennenzulernen und evtl. zu überarbeiten. Tatsächlich spielen dabei Werte, also ethische Fragen, eine wichtige Rolle – also ob es mir möglich ist, in Übereinstimmung mit meinen Werten zu leben. Gerade in einer Klinik können die großen Lebensfragen auftauchen, also: Wieso passiert mir das? Warum geht es mir so und anderen nicht? …
Sie erwähnt ihre systemische Perspektive, aus der heraus sie immer nach dem Kontext einer Erfahrung fragt. Es braucht einen Horizont und einen Rahmen für das, was ich tue und für das Ziel, an das ich gelangen will.
Meditation und Psychotherapie
Meditation und Achtsamkeit in der Psychotherapie wirft viele Fragen auf. Was wird da gemacht? Ist es im Prozessverlauf? Welche Methoden kommen zum Einsatz? Auf welchen Zustand möchte ich evtl. hinaus? Was ist nachhaltig? …
Es wurden bereits zahlreiche klinische Studien zur Wirkung von Achtsamkeit an vielen Menschen mit allen möglichen Diagnosen erforscht. Aber eine Grundfrage nämlich: Was wirkt eigentlich für wen, wann, wie genau? Also die Grundfrage von Passung oder Individualisierung ist noch weitgehend unbeantwortet. An dieser Stelle plädiert sie für ein Methoden-übergreifendes Vorgehen.
Nun wirft sie noch einen Blick auf Bindung, Beziehung und therapeutische Allianz und die Frage, was diese Allianz befördern kann. Gerade wenn psychotherapeutische Interventionen und Achtsamkeitselemente verwendet werden, entsteht die Frage, wie beides zusammenwirkt und welche tieferen Prozesse damit einhergehen. Wir befinden uns also in einem hochdynamischen Forschungsfeld, das uns noch viele Erkenntnisse verspricht.
Achtsamkeitsbasierte Interventionen
Achtsamkeit ist eine besondere Form der Aufmerksamkeitslenkung, die möglichst nicht wertend und akzeptierend durchgeführt wird. Dabei verbleibt die Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick. Bei regelmäßigem Üben ergibt sich dann eine verkörperte Erfahrung, die womöglich zu einer Veränderung der inneren Haltung führt, die sich positiv auf die Lebensqualität auswirken kann.
Zu unterscheiden wären zwei Grundformen: Die Fokus Aufmerksamkeit und die Offene Wahrnehmung. Fokus Aufmerksamkeit übt, seinen Geist auf einem gewählten Objekt zu halten. Auch wenn die Aufmerksamkeit wandert, sie immer wieder zum Objekt zurückzubringen. Damit können Klient*innen die Fähigkeit erwerben, z. B. ihren Grübeleien zu entkommen.
Offene Wahrnehmung umschreibt die Fähigkeit der Selbstdistanzierung, also sich gewissermaßen beim Leben und Erleben zuzusehen, ohne sich auf die emotionalen Komponenten des Geschehens einzulassen. Dabei geht es nicht darum, den Geist leer werden zu lassen, sondern die Unterscheidungsfähigkeiten für innere Zustände zu verfeinern.
Achtsamkeit
Frau Aguilar-Raab versteht das als einen erweiterten Bezugsrahmen, der sich auf diese Art entwickeln kann. Dazu bietet sie uns ein Zitat an: „Achtsamkeit ist eines der zentralen Dinge, die uns helfen, unseren Werten treu zu bleiben und entsprechend zu handeln, während der Umstand, „uns selbst zu vergessen“, häufig die Ursache dafür ist, unser Handeln nicht auf unsere Werte abzustimmen.“ Somit kann Achtsamkeit uns dabei helfen, unseren inneren Kompass wiederzufinden und ihn auch zu nutzen.
Offene Wahrnehmung ist Meta-Denken, also Denken über das Gedachte aus der Beobachterposition. Die Fähigkeit zum Meta-Denken verhilft uns zu Orientierung und Selbstklärung unserer Motive, Ziele und Handlungen sowohl im Selbstumgang als auch im sozialen Kontext.
Wirksamkeit von Achtsamkeit
Es gibt bereits etliche Studien und Veröffentlichungen zur Wirksamkeit von Achtsamkeit – ihre Anzahl ist noch am Wachsen. Es zeigen sich positive Effekte ab, allerdings sind zahlreiche Studien methodisch fragwürdig.
Auch und vor allem können Menschen in helfenden Berufen von Achtsamkeit profitieren, denn sie sind überdurchschnittlich häufig von Burn-out, Depression bis hin zur Suizidalität betroffen. In diese Gruppe zeigte die Pflege von Selbstmitgefühl große Wirkung.
Gruppensettings, die über 10-12 Wochen gehen und noch einen Intensivtag bieten, schneiden dabei am besten ab. Als Quintessenz ergibt der derzeitige Forschungsstand die Wirkmechanismen:
Aufmerksamkeitsregulation
Emotionsregulation
Selbstwahrnehmung (auch Körpergewahrsein)
>Selbst und Co-Regulation
Der Aspekt der Regulation steht also im Zentrum des Achtsamkeitstrainings bzw. deren Praxis. Dabei geht es nicht darum, negative Erfahrungen, Gefühle etc. zu vermeiden, sondern angemessen mit ihnen umgehen zu können.
Mitgefühlsbasierte Interventionen
Zur Einführung in diesen Themenkreis bietet uns die Vortragende einige Begriffsdefinitionen. Der ursprüngliche Begriff „empatheia“ stammt aus dem Griechischen und bedeutet „Leidenschaft“. Die phänomenologische Definition umschreibt Empathie mit Einfühlungsvermögen und meint damit eine Antwort auf unmittelbar wahrgenommenen, vorgestellten, erschlossenen Zustand in einem anderen.
Empathie wird in psychodynamischer Sichtweise operationalisiert, d.h. als Grundelement der Persönlichkeit betrachtet, welches mehr oder weniger ausgeprägt sein kann. Dabei umfasst Empathie mehr als nur Gefühle, sie beinhaltet auch Gedanken über den anderen, ein sich in den anderen hineindenken. Es gibt eine Reihe von Konzepten, die sich mit dieser Fähigkeit auseinandersetzen, auch die neuronale Grundlagenforschung ist damit befasst. Frau Aguilar-Raab bringt es mit dem Resonanz Begriff auf den Punkt, also mit jemandem in Resonanz kommen.
Mitleid hingegen ist die übertriebene Identifikation mit dem Schmerzlichen und Leidvollen. Hier verlieren wir den therapeutischen Bezugsrahmen und damit die therapeutische Wirksamkeit.
Es kommt also darauf an, Mitgefühl zu kultivieren. Das definiert sie folgendermaßen: „Sensitivität gegenüber Leiden in uns und in anderen mit dem Wunsch, dieses zu lindern und zu verhindern.“ Mitgefühl hat fünf Komponenten (affektive, kognitive, motivationale und behaviorale).
Erkennen von Leiden
Universalität von Leiden verstehen
Empathie
Distress Toleranz
Motivation/Verhalten zu zeigen, das zur Linderung des Leidens beiträgt, was eben nicht Mitleid ist, das mit leidet ohne Voraussicht und aktiven Veränderungswunsch. Sie plädiert für die Kultivierung einer „inneren Weite“, die uns Toleranz für das Unangenehme bietet. Innere Weite gewährt Freiheitsgrade für das Fühlen, Denken und insbesondere das Handeln. Das ermöglicht es auch mit schweren Verlusten umgehen zu können.
Frau Aguilera-Raab berichtet uns von ihrer Ausbildung zum „Cognitive Based Compassion Training“ und erläutert uns kurz die Stufen dieser Ausbildung.
Erlernen von Achtsamkeit
Zunächst geht es darum, körperliche Sicherheit zu finden, denn diese ist die Voraussetzung schlechthin, wenn ich an einer Veränderung arbeiten möchte. Im zweiten Schritt geht es um die Übung selektiver Aufmerksamkeit, die Fokussierung und die Unterbrechung (Inhibition) von Gedanken. Weiter wird das Meta-Gewahrsein trainiert und damit De-automatisiert und De-Reaktivität gestärkt. Im vierten Schritt geht es um Selbstfürsorge, Selbstverantwortung und Selbstmitgefühl. Im fünften Schritt ist das Thema „Menschliche Gemeinsamkeit“, d.h. eine erweiterte Identifikationsmöglichkeit zu entwickeln. Der sechste Schritt dreht sich dann um Interdependenz, Nähe und Wertschätzung.
Wir bekommen noch weitere Modelle vorgestellt, die Mitgefühl von Mitleid unterscheiden bzw. ein Affekt-Regulations-Modell erklären. Letzteres umfass ein Antriebssystem, eine Fürsorge- und ein Alarmsystem, die mit typischen Gefühlen einhergehen und mehr oder weniger gut aufeinander abgestimmt sind.
Auch hier dürfen ein paar Evidenzen nicht fehlen und es gibt sie tatsächlich auch. Die Compassion-Focused Therapy führt zu mehr Selbstmitgefühl – weniger Grübeleien (Ruminationen), weniger Selbstkritik und vermehrter Resilienz gegenüber Psychopathologien, dank besserer emotionaler Selbstregulation.
Es folgt nun noch eine ausführliche Darstellung eines eigenen Forschungssettings mit Paaren. Die Ergebnisse sind mehrdeutig – es scheint genügend Zeit und Übung zu brauchen, bis die Methode befriedigende Wirkungen zeigt. Weiter, dass Mitgefühl, Mentalisierung und Empathie wichtige Wirkgrößen darstellen.
Sie schließt ihren Vortrag mit einem Zitat, das mutmaßlich von Viktor Frankl stammt: „Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktionen. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit“.
Ein sehr reichhaltiger und eloquent vorgetragener Input. Wer ihn sich ganz ansehen mag, kann das hier tun.