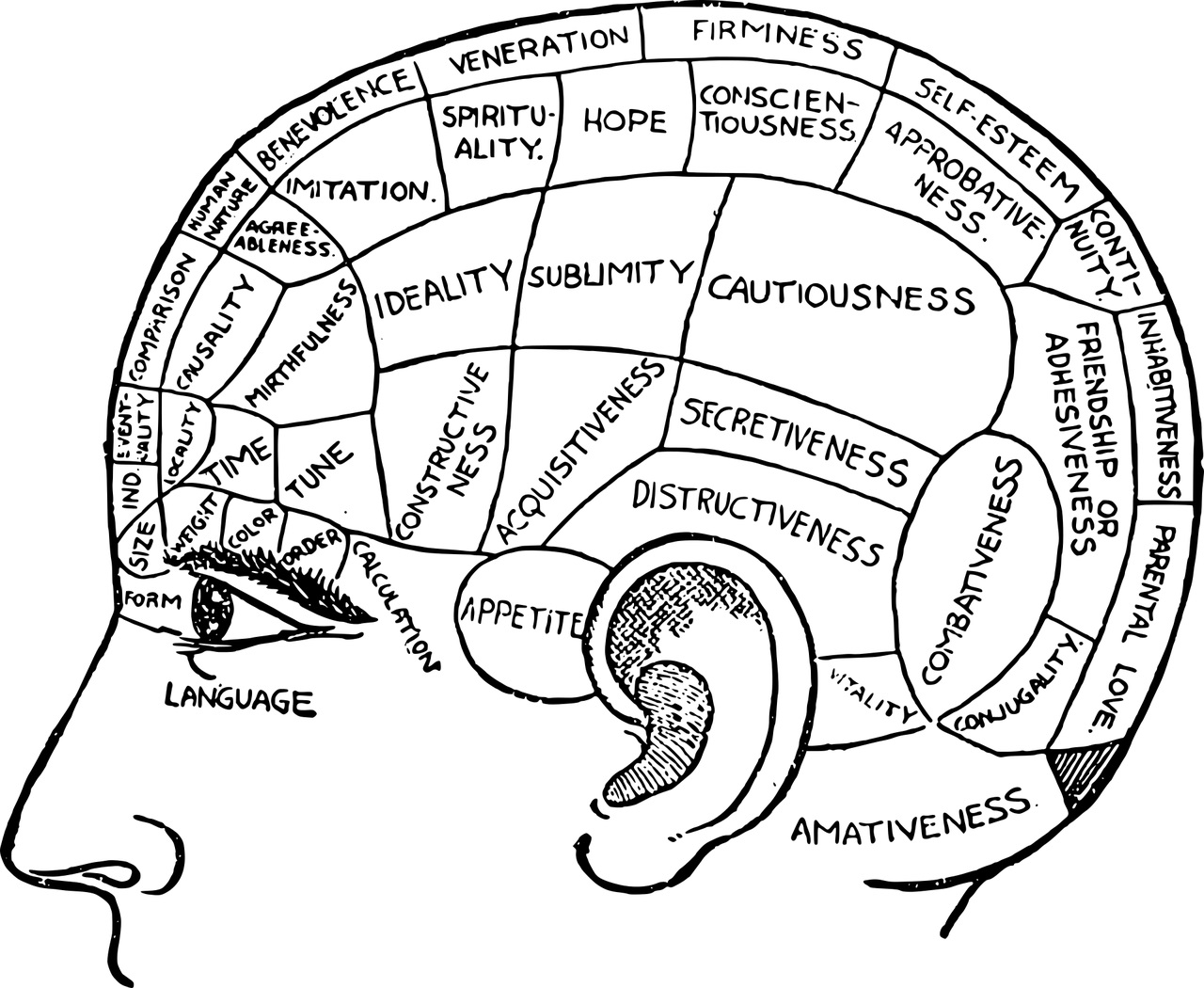Bericht vom Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg, Vortrag von: Philipp Kanske, Prof. Dr. rer. nat., Klinische Psychologie und Behaviorale Neurowissenschaft, TU Dresden
Einführung
Empathie und Achtsamkeit sind die Themen der Stunde in der Psychotherapie und der Neuro-Psychotherapie. Der Untertitel des Vortrags lautet: „Psychopathologie und Training des sozialen Gehirns“. Er stimmt uns auf den Schwerpunkt der Forschung von Herrn Kanske ein.
Warum beschäftigt sich die Forschung mit diesen Themen? Weil die kognitiven Prozesse in sozialen Interaktionen höchst komplex sind. „Wie können wir einander überhaupt verstehen?“ Wäre eine weitere Frage, und eine Teilantwort darauf lautet: „Theory of Mind (ToM)“. Dieser Begriff umschreibt die Fähigkeit, dass Menschen, etwa ab dem vierten Lebensjahr, imstande sind, sich vorzustellen, dass andere Menschen einen eigenen Gesichtspunkt, eigene Gedanken, Absichten und Wünsche haben, wie man selbst. Diese Fähigkeit wird gerne auch als „soziales Gehirn“ bezeichnet.
Soziale Integration
Soziale Integration ist eine zentrale Quelle von Resilienz, denn ohne sie drohen Einsamkeit, der Verlust sozialer Unterstützung und das Risiko zu sterben erhöht sich messbar. So ist der Verlust von sozialer Teilhabe für das Leben riskanter, als z. B. zu rauchen. Und, vielleicht überraschend, es sind die kleinen Begegnungen des Alltags, wie der Nachbar mit dem Hund, die Briefträgerin, die Verkäufer*innen, die einen grüßen und denen man zulächelt, die einen noch stärken positiven Einfluss haben, als die familiären Kontakte.
Das Institut von Herrn Kanske hat dazu in der aktuellen Corona Situation geforscht. Menschen mit psychischen Vorerkrankungen waren deutlich mehr von den Folgen des Lockdowns betroffen, als Menschen ohne Vorerkrankung. Der Stress, der von sozialer Isolation induziert wird, wirkt sich dabei auch subjektiv aus. Die empfundene soziale Isolation, die nicht mit der tatsächlichen Anzahl der Kontakte übereinstimmen muss, wirkt pathogen. Sie kann sogar dazu führen, dass Menschen sich empathisch unverbunden erleben.
Empathie
Was wir unter „Empathie“ verstehen, hat eine große Bandbreite. Es geht um solche Aspekte wie: Einfühlungsvermögen, soziale Motivation, Perspektivwechsel (ToM), Sozialverhalten, Mitgefühl, soziale Aufmerksamkeit, Personenerkennung, Bindung, Gesichtswahrnehmung. Herr Kanske hat daraus das Einfühlungsvermögen, das Mitgefühl und den Perspektivwechsel ausgewählt, um sie näher zu erforschen.
Was er herausbekommen möchte, ist, wie sich soziale Kognition und Emotion, bestehend aus Empathie und Mitgefühl (positive Gefühle) sowie der ToM im weiteren auf das Sozialverhalten auswirken.
Neuronale Befunde
Für solche Forschungen wird heute gerne ein „Scanner“ in Anspruch genommen, denn nur so können Hinweise darauf gefunden werden, welche neuronalen Strukturen die Grundlagen für Mitgefühl darstellen. Die Proband*innen liegen also in der Röhre und sehen einen kleinen Film. Darin berichtet ein Mensch von einem Vorfall – einmal eher neutral und das andere Mal eher emotional. Danach werden die Proband*innen befragt. Zunächst zu ihrer Stimmung, danach, ob sie Mitgefühl empfinden und dann noch, ob sie die Perspektive der Erzähler*in nachvollziehen können.
Da solche Forschungen schon seit längerer Zeit betrieben werden, war das Ergebnis nicht sonderlich überraschend. Die Gehirnstruktur, die bei Stimmungen eine zentrale Rolle spielt, ist die „Insula“. Interessanterweise korreliert die Aktivität der Insel allerdings nicht unbedingt mit der subjektiven Wahrnehmung. Sie kann hohe Aktivität aufweisen, ohne dass der Betreffende eine große Stimmungsänderung wahrnehmen kann.
Das positive Mitgefühl (compassion) braucht das „Striatum“ für sein Erscheinen. Es hat bekanntermaßen mit Fürsorgeverhalten zu tun, ebenso mit Belohnung und lernen. Das positive Mitgefühl unterscheidet sich also auch auf neuronaler Ebene von der Gestimmtheit.
Bei der Untersuchung zu Fragen der ToM stellte sich heraus, dass hier insbesondere der tempoparietale Übergang eine wichtige Rolle spielt. Diese Region scheint eine Art „Generalfaktor der sozialen Intelligenz“ zu sein.
Zusammenhänge
Haben nun Stimmung, Mitgefühl und ToM etwas miteinander zu tun? Bedeutet gutes Einfühlungsvermögen auch gutes Eindenkvermögen? Nein! Es zeigen sich keine Korrelationen zwischen diesen beiden Vermögen. Aber um das noch genauer zu überprüfen, hat das Institut von Herrn Kanske eine große Metaanalyse zur sozialen Neuroforschung durchgeführt.
Das Ergebnis zeigt, dass es eine ganze Reihe von Testaufgaben für die Erforschung der Empathie, als auch der Erforschung der ToM gibt. Es gibt aber auch noch einen Zwischenbereich, der sich nicht so eindeutig zuordnen lässt. In diesem Bereich zeigen sich Verbindungen von Gehirnstrukturen, die sonst eher selten miteinander interagieren. Hier findet sich auch am ehesten eine negative Korrelation zwischen Mitgefühl und ToM, wenn ich nämlich mit dem einen beschäftigt bin, rückt das andere eher in den Hintergrund. Gerade komplexe Aufgabenstellung werden auch komplex verarbeitet. Hier steht die Forschung noch ziemlich am Anfang.
Die Hoffnung besteht, dass auf diese Art auch psychische Störungen besser verstanden werden können, denn bei vielen psychischen Störungen sind es genau die Fähigkeiten der ToM und der Empatie, die beeinträchtigt sind.
Soziales Verhalten
Um einen Einblick in den Zusammenhang von Empathie und Sozialverhalten zu bekommen, wurde dem experimentellen Setting eine weitere Frage hinzugefügt, nämlich: Ob die Proband*in bereit wäre, der Person in dem Film zu helfen. Und ja, der Wille zu helfen war zunächst eindeutig stärker, wenn die Geschichte emotional erzählt wurde. Die ToM hatte allerdings kaum einen Einfluss auf die Hilfsbereitschaft.
Ein weiterer Test war ein „Spendenspiel“. Es ging darum von geschenkten fünfzig Euro etwas an eine gemeinnützige Organisation zu spenden. Viele Spenden wurden gesammelt und die Befragung danach versuchte herauszufinden, ob empathische Gründe oder Perspektivgründe für das Spenden eine Rolle gespielt haben. Diese Experimente wurden dann auch für Vorhersagen geprüft, und tatsächlich kann man mit einem vorhergehenden Scan der Affektivität zu gut 60 % vorhersagen, ob der Proband spenden wird.
Nun kommt noch ein kleiner Exkurs. Im Rahmen der obengenannten Experimente wurde eine kleine Variation vorgenommen. Die Proband*innen bekamen neutrale oder emotionale Musik eingespielt. Im Ergebnis stellt sich heraus, dass emotionale Musik das Mitgefühl verstärkt, was aber nicht der Fall war, wenn die Geschichte neutral erzählt wurde. Auf die ToM hatte die Musik keinen Einfluss.
Achtsamkeit & Co
Herr Kanske hat auch im Team von Tanja Singer mitgearbeitet, die die Effekte von Achtsamkeit erforscht hat und weiter erforscht. Worum geht es? Es gibt drei Arten von Trainingsmodulen, das sind: Präsenz, Affektivität und Perspektive. Präsenz umfasst die Aufmerksamkeit, innere Achtsamkeit, auf den Atem und den Körper zu spüren. Affekt umfasst Mitgefühl, prosoziale Motivation, Akzeptanz von Gefühlen. Das wurde mit Freundlichkeits- und Mitgefühlsmeditationen geübt und in einer Partnerübung als Erzählung über alltägliche Schwierigkeiten und Dankbarkeit. Das Perspektivmodul umfasst die Metakognition (denken über Gedanken), eigene und andere Perspektiven zu erfassen. Als Übung dafür ist die Meditation der Beobachtung der eigenen Gedanken geeignet und das Modell der „Inneren Familie“. Darin kommen verschiedene „Familienmitglieder“ zu Wort, wenn es um irgendein Thema geht. Ein Proband erzählt einem anderen eine Wortmeldung und dieser darf erraten, um welches Familienmitglied es sich handelt.
Training
Insgesamt dauert so ein Training länger als ein Jahr. Nach einem Retreat zur Einstimmung werden die Gruppen geteilt. Beide Gruppen beginnen mit Präsenzübungen, aber dann macht eine Gruppe mit Affektivität weiter und die andere mit Perspektive, die andere Gruppe in umgekehrter Reihenfolge. Dazu gab es noch eine Kontrollgruppe, die gar nichts trainiert hat.
Bei der Nachuntersuchung wurde umfangreich ermittelt, welche Veränderungen sich ergeben haben. Als Ergebnis zeigte sich, dass Mitgefühl vor allem nach dem Affektmodul angestiegen ist, und dass sich die Fähigkeit der ToM vor allem nach dem Perspektivmodul gesteigert hat. Aber es gab nicht nur diese relativ weichen Ergebnisse, sogar in der Gehirnstruktur wurden Veränderungen festgestellt. Die „Corticale Dicke“ also die Zellen der Hirnrinde haben sich vermehrt und zwar entsprechend den Bereichen, von denen wir schon weiter oben gehört haben – also z.B. die Insel, wenn es um Empathie geht.
Selbstberichtetes Sozialverhalten
Natürlich wurden die Proband*innen auch mit Spielen getestet. Sie zeigten vermehrt Altruismus, Großzügigkeit, Vertrauen und Hilfsbereitschaft. Reziprozität stieg allerdings nur durch das Affektmodul an. Wurden allerdings die Selbstbeschreibung mit den tatsächlichen prosozialen Verhalten verglichen zeigten sich Abweichungen. Die Menschen handelten nicht so nobel, wie sie selbst von sich glaubten.
Psychosozialer Stress
Stress wird gerne mit dem „Trierer Stresstest“ gemessen, der aus einer unerfreulichen Prüfungssituation besteht. Es zeigte sich, dass das reine Präsenztraining keinen Effekt auf den Stresslevel hat. Aber das gesamte Training war durchaus in der Lage, den Stress zu lindern.
Subklinische Veränderungen
Alle Proband*innen waren psychische gesunde Menschen. Aber auch solche Menschen zeigen in Tests subklinische Anzeichen wie z. B. Depressivität, Ängstlichkeit, Narzissmus, Einsamkeit etc. Die Frage war nun, ob sich hier nach dem Training eine Veränderung eingestellt hat. Das lies sich spezifisch nicht ermitteln, aber über die Summe der festgestellten Veränderungen konnte man immerhin aussagen, dass ein Training absolviert worden war.
Bei noch genauerer Auswertung wollten die Forscher*innen anhand der Testveränderungen vorhersagen, ob der Betreffende z.B. ein Affekt- oder ein Präsenzmodul absolviert hat und hier ergab sich ein positives Ergebnis. So ergaben sich spezielle Cluster, die zeigten für welche Bereiche, welches Modul am hilfreichsten ist. So hilft Affekt Training z.B. für Kardiovaskuläre Problem oder auch Ängstlichkeit; Perspektivtraining ist u.a. hilfreich für die Stresswahrnehmung, und Präsenz Training hilft bei Unsicherheit.
Fazit
Herr Kanske fasst zusammen: Empathie, Mitgefühl und ToM sind unterschiedliche Aspekte der sozialen Kognition und Emotion. Es ist möglich, diese Fähigkeiten gezielt „anzusteuern“ und einzuüben. Betroffene können so von ihren neuen Fähigkeiten profitieren, dass sie über ein verändertes Sozialverhalten neue soziale Situationen mitkreieren, die wiederum die erworbenen Veränderungen weiter unterstützen.
Den ganzen Vortrag kann man sich hier anhören.