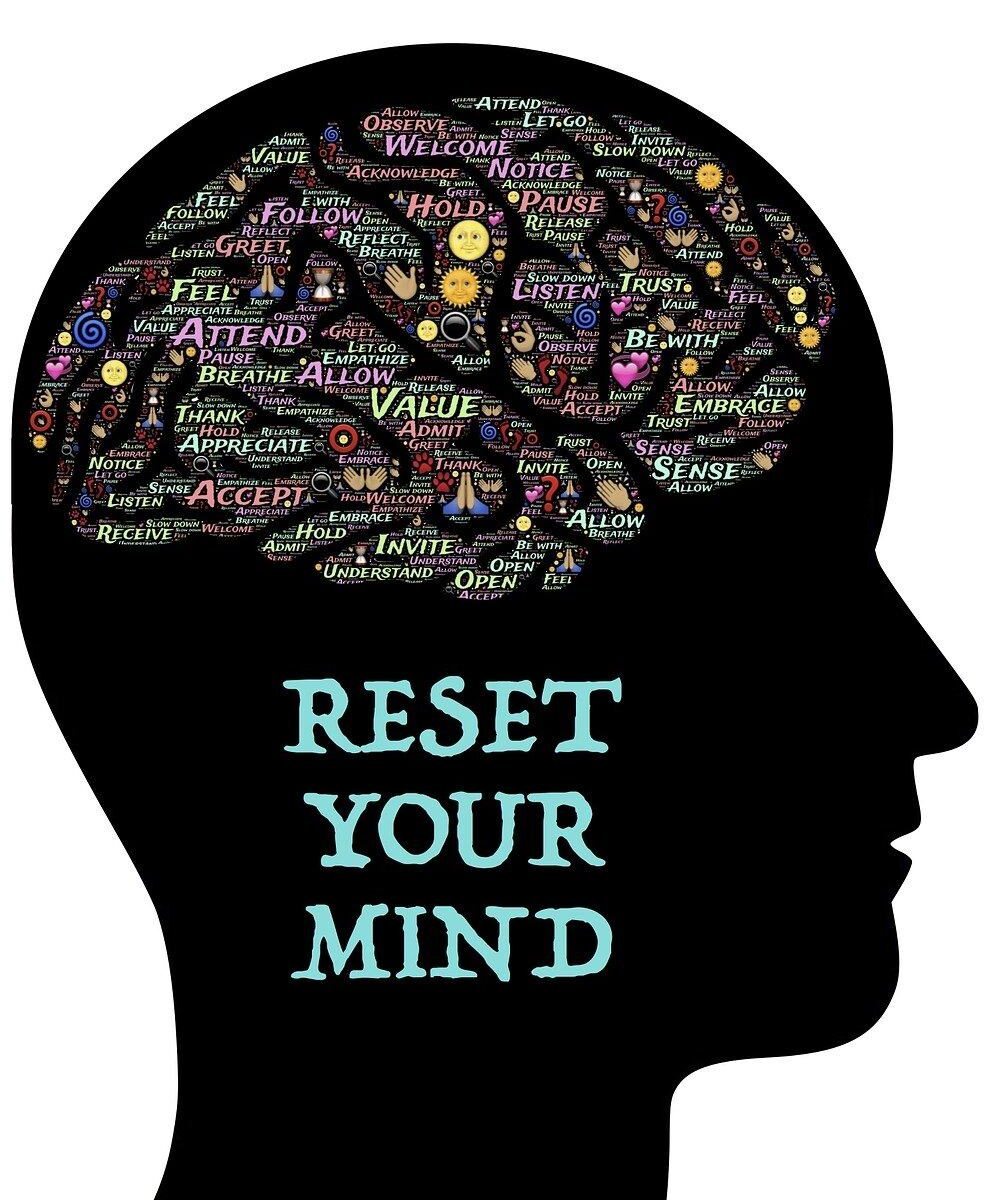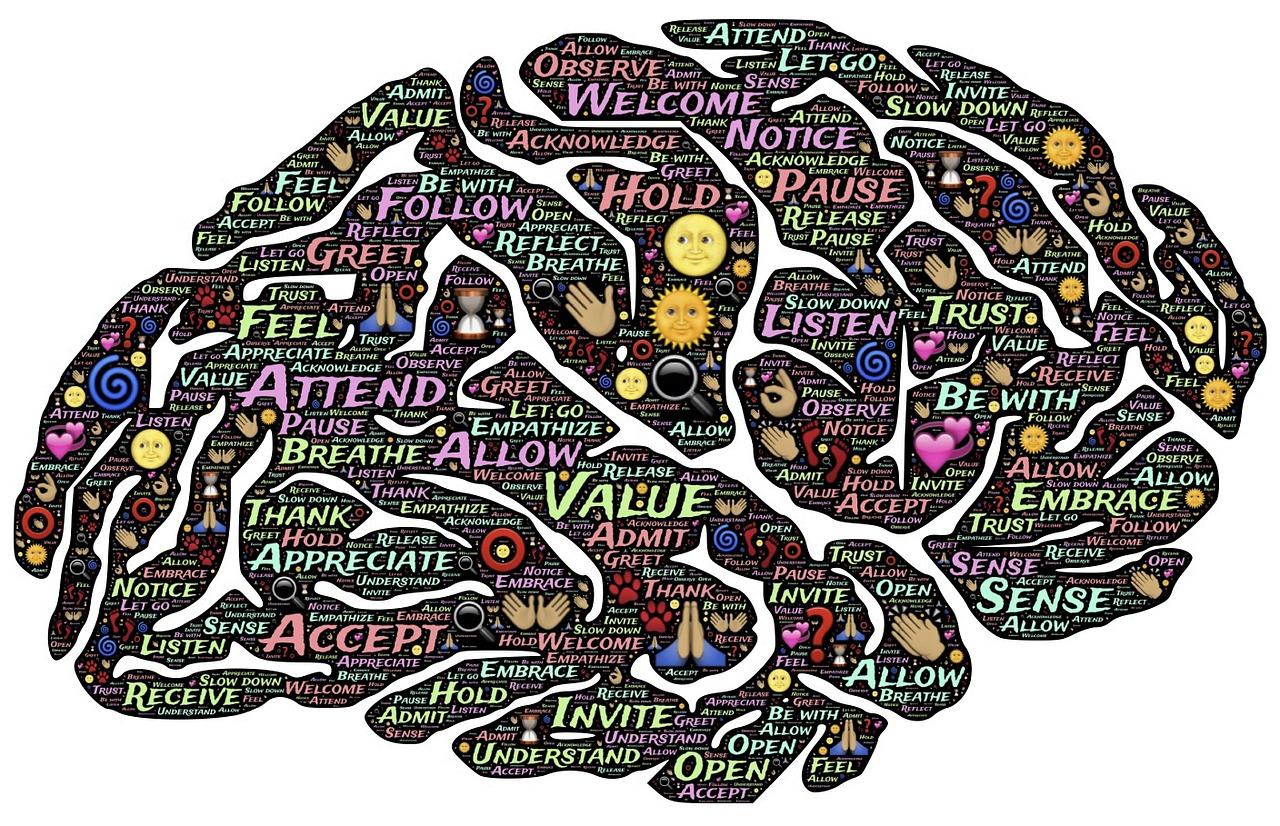Bericht vom 09.05.23 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Eckhard Roediger Dr., Leiter des Instituts für Schematherapie, Frankfurt am Main: „Neue Entwicklungen in der Schematherapie: Die Einbeziehung der metakognitiven Perspektive und des Körpers“
Herr Roediger stellt uns die Struktur seines Beitrags vor:
- Empirie
- Konzeptuelle Veränderungen
- Praktische Demonstration
Einleitung
Wir erfahren zunächst, dass Schematherapie keine eigenständige Methode ist, sondern eine Spezialtherapie für Persönlichkeitsstörungen, also für Menschen, die in Interaktionen eher unflexibel sind und Schwierigkeiten haben, sich anzupassen.
Schematherapie (ST) ist eine der vier anerkannten Borderline-Therapien. Die anderen sind: Die Übertragungsfokussierte Therapie, die Mentalisierungsbasierte PT und die Dialektisch-Behaviorale PT.
Die Studienlage
Die Schematherapie wirkt, wenn die Therapeut*innen die Techniken richtig anwenden. Das bedeutet, dass Nachschulungen in der spezifischen Technik, den Outcome der Therapie erhöhen. Schematherapie ist zudem nicht Borderline spezifisch sondern im ganzen Spektrum (Cluster A, B, C) der Persönlichkeitsstörungen wirksam.
Vergleichsstudien, die ST mit anderen Therapiemethoden für die Borderline PS verglichen haben, ergeben ein sehr positives Bild für die ST.
ST weist in diesen Studien geringere Drop-Out Raten und bessere Follow-Up Effekte als alle anderen Therapieverfahren auf. Außerdem erreichen erfolgreiche Patient*innen eine höhere Lebenszufriedenheit als Patient*innen, die mit anderen Therapien ebenfalls erfolgreich behandelt worden sind. Die positiven Effekte der Therapie stiegen sogar mit der Zeit an.
Weitere Vergleichsstudien von Therapien z.B. als kombinierte Gruppen- und Einzeltherapie und Paartherapie erbrachten ähnliche Ergebnisse.
Herr Roediger denkt, dass insbesondere die Imagination als zentrale Technik der ST dies begünstigt. Auch das Einüben von „Self-Compassion“ (Selbst-Mitgefühl) trägt zu dem Ergebnis bei und die Fähigkeit zur Meta-Kognition gehört für ihn ebenso dazu. Die Klienten Erleben, Erklären und Erzählen dann neu.
Konzeptuelle Entwicklungen
Historisch kann man drei Stufen der ST identifizieren. Vor dreißig Jahren entwickelte Jeffrey Young einen ersten Ansatz. Er beschrieb bereits die Schemata – man könnte diese als komplexe Reiz-Reaktionsmuster verstehen, für die ein bestimmtes Bewältigungsmuster entwickelt wurde – ein Modus des Umgangs.
Ein zweiter Ansatz kann auf Arntz/Jacob zurückgeführt werden. Darin werden die Umgangsmodi als „Teil-Selbst“ betrachtet. Es gibt darin eher wenig Schema Bezug und wird als Therapie für maladaptives Verhalten verwendet.
Was Herr Roediger uns heute vorstellt, ist der zeitgenössischer Ansatz. Es geht um eine kontextuelle und prozessbasierte Schematherapie, die sich einer modernen Begrifflichkeit bedient.
Dieser aktuelle Ansatz vereint das unmittelbare Körpererleben mit der Imagination. Dadurch wird das episodische Gedächtnis erreicht und man umgeht so die Narrationen (Erzählungen), die darum herum konstruiert wurde.
Zentrale Elemente der Schematherapie
Das Therapiemodell der ST dient als Grundlage für die Fallkonzeption und Therapieplanung. Es soll möglichst einfach und anschlussfähig sein.
Die spezifische therapeutische Beziehung orientiert sich an der Eltern-Kind-Beziehung. So kann sich eine hohe emotionale Dynamik im Beziehungsfeld entwickeln und das Ziel der Nachbeelterung kommt eher in Reichweite.
Die zeitgenössische ST verwendet erlebnisaktivierende Techniken, die durch Imagination das emotionale Erleben von kritischen Dialogen eindrücklich reinszenieren. Die Episode wird emotional nacherlebt und in der erwachsenen Position aufgelöst und dekonstruiert.
Einfaches Therapiemodell
Das heutige Erscheinungsbild der Klient*innen ist geformt von kindlicher Erfahrung. Es ist der Schmerz des Kindes, dessen Bindungs- und/oder Autonomiebedürfnis frustriert wurde. Diese Erfahrung brennt sich tief ein. Das verletze Bindungsbedürfnis wird als Verletzlichkeit und Abhängigkeit von Anderen verinnerlicht. Die Beeinträchtigung der Autonomieentwicklung führt zu Selbstverständnis als inkompetenter Versager.
Bindung und Autonomie betrachtet Herr Roediger als die fundamentalen Pole der Persönlichkeit. Die frühen Erfahrungen bilden Schemata, die sich in Situationen, die Bindungs- oder autonomierelevant sind, aktivieren.
Die erste Komponente des aktivierten Schemas macht sich als Basisemotion (Angst, Trauer) körperlich bemerkbar. Der bevorzugte Ort dafür ist im Bauch- und Brustbereich. Die sozialen Gefühle wie Schuld, Verachtung oder Scham werden eher im Hals, Brust oder Kopfbereich wahrgenommen.
Nun kommt eine zweite Komponente ins Spiel. Diese ist der „Innere Kritiker“ (die Stimme im Kopf), der sich aus den übernommenen Bewertungen anderer geformt hat. Sätze wie: „Du taugst halt nichts.“ Können hier auftauchen.
Diese beiden Komponenten stehen inkonsistent und unvereinbar nebeneinander. Sie spielen auf der „hinteren Bühne“, die von außen nicht sichtbar ist. Äußerlich sichtbar ist die soziale Rolle, welche die „bisher beste Lösung“ dieses Schemas darstellt. Nicht selten weist diese bereits klinische Symptome auf.
In der Therapie wird nun ein Stuhl angeboten, auf dem die Basisemotion erlebt werden kann. Auf einem anderen Stuhl kann dann der innere Kritiker seine Bewertungen abgeben. Nun kommt aber ein aktueller und kompetenter Erwachsener (Beobachterperspektive) hinzu, der hilft, diese Bewertungen zu überprüfen und zu überarbeiten.
Die Beobachterposition ist auch der Ort der Metakognitionen – des Nachdenkens über das Denken. Von dort aus ist es in aller Regel leicht, den Kritiker zu verurteilen und wegzuschicken. Ebenfalls aus dieser Position wird das Kind-Erleben getröstet und verstanden. Die Emotionen des Kindes werden angenommen und verstanden.
Schematheorie
Die Übersicht über das Spektrum verschiedener Schemata wurde aus dem berühmten „Still-Face Experiment“ von Tronnick abgeleitet. Darin lassen sich gut die verschiedenen Strategien erkennen, die so manchen Mitmenschen noch im Erwachsenenalter Probleme bereiten. Es geht um das Kontinuum von Ängstlichkeit, Unterwerfung für die Regulation der Bindungsorientierung vs. Ärger, Externalisierung für die Regulation der Autonomie.
Daraus ergeben sich vier Lösungsversuche: Unterordnung/Aufopferung – Passive Gefühlsvermeidung (Erstarrung) – Aktive Selbstberuhigung (Flucht) – Überkompensation/Dominanz (Kampf)
Diese Lösungsversuche lassen sich auf mit der Polyvagal Theorie von Steven Porges erklären. Der Sympathikus aktiviert die Flucht/Kampf Seite, der dorsale Vagus die Unterordnung und Erstarrung und der ventrale Vagus erlaubt den angemessenen erwachsenen Umgang mit den Herausforderungen.
Um den erwachsenen Umgang mit Herausforderungen zu stärken, hilft es, sich in Achtsamkeit zu üben. Die Fähigkeit zu schulen, Abstand zu automatischen Gedanken und Bewertungen herstellen zu können.
Damit zusammen hängen auch solche Fragen wie: Wo will ich hin? Was sind meine Werte und Bedürfnisse? Darüber nachzudenken und uns evtl. mit anderen auszutauschen fördert einen konstruktiven Lebensstil und erleichtert es, das Spannungsfeld von Selbstbehauptung und Bindungsorientierung auszubalancieren.
Man kann dies auch einen offenen Stil nennen: offen wahrnehmen, zentriert neubewerten, engagiert handeln.
Die Praxis
Für die praktische Anwendung genügen zwei Stühle. Der eine ist für die konfrontierende Position. Auf dieser wird das Schema aktiviert. Es kann vom inneren Kritiker, einem Täter, Stellvertreter, Therapeut besetzt werden.
Der zweite Stuhl ist für die imaginative Position. Hier wird mit geschlossenen Augen die Szene imaginiert und die Gefühle des Körpers wahrgenommen. Diese Position wird vom Therapeuten betreut und fürsorglich unterstützt. Der Therapeut bereitet mit seinem Verständnis die Fähigkeit zum Selbst-Mitgefühl vor.
Dann geht es in die Beobachterrolle. Das ist der erwachsene und kompetente Mensch, der (meist mit offenen Augen) die Szene beobachtet und neu bewerten kann. Mitgefühl für das Kind empfindet und Ärger auf Täter und Kritiker. Diese Wertungen sind tief in unserer Menschlichkeit verankert und zuverlässig abzurufen.
Zum Abschluss demonstriert Herr Roediger das Vorgehen mit einer Freiwilligen. Das wirkt natürlich etwas künstlich, ist aber dennoch sehr eindrucksvoll. Die Struktur des Vorgehens ähnelt sich in allen Stunden.
Ich fand dies einen sehr gut gehaltenen und interessanten Vortrag, der mir viel Inspiration geschenkt hat.
Hier geht’s zum Vortrag: