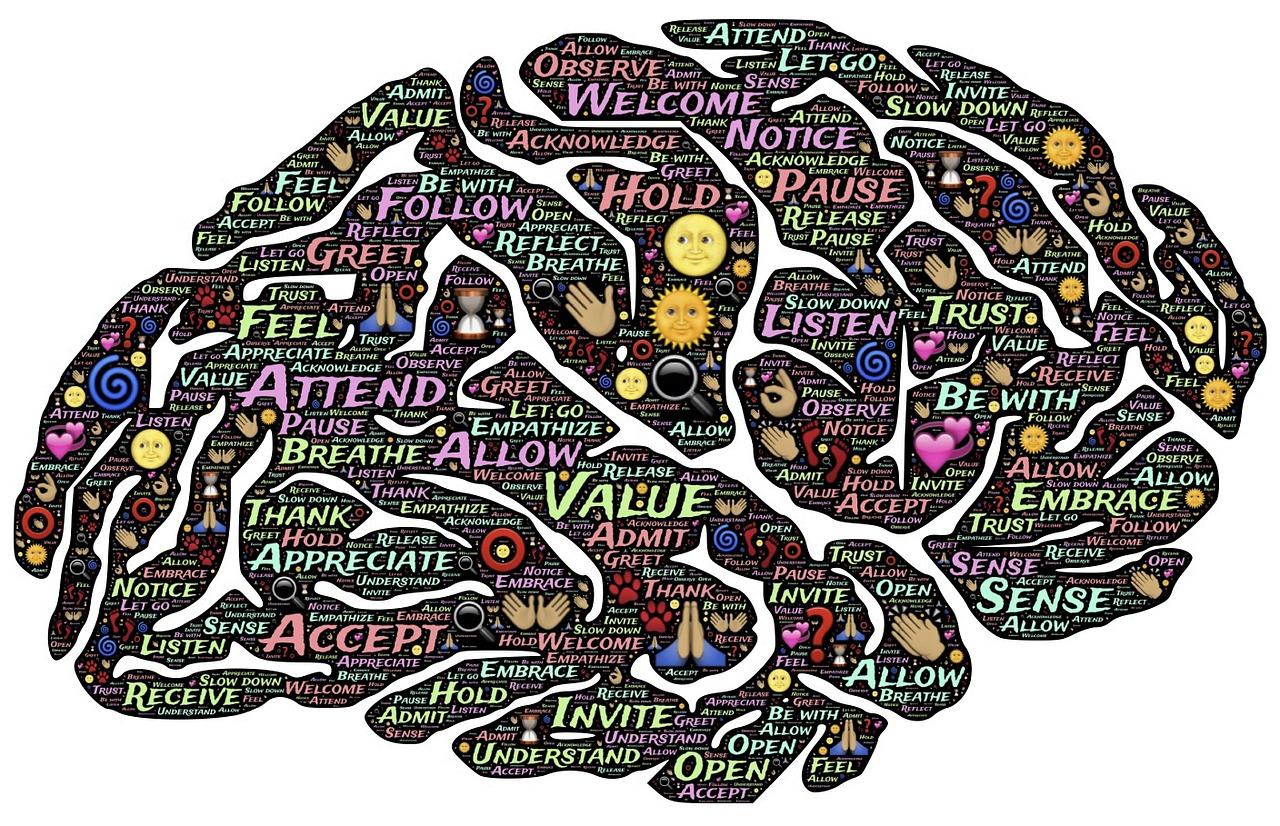Bericht vom 02.07.24 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Fynn-Mathis Trautwein Dr. rer. nat, Systemische Gesundheitsforschung, Klinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Universitätsklinikum Freiburg:
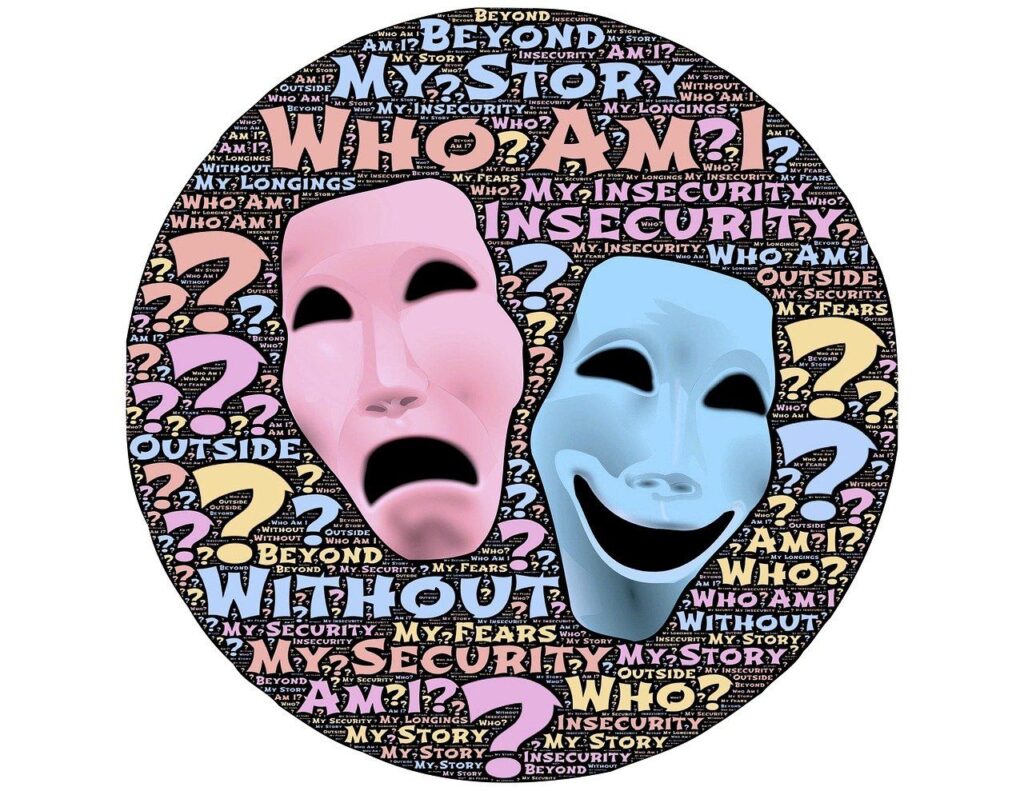
„Das Selbst im Spiegel der Meditation: Kontemplative und neurowissenschaftliche Perspektiven“
Das sog. Selbst und das Selbsterleben stehen auch im Zentrum von meditativer Erfahrung. Meditation hat Effekte auf das Selbsterleben, einige davon sind erwünscht, andere weniger. Herr Trautwein möchte uns damit bekannt machen, was die Forschung heutzutage über die neuronalen Korrelate dazu herausgefunden hat. Aber nicht nur, auch einen phänomenologischen Zugang möchte er mit uns erkunden. Dieser trägt den Namen „Neurophänomenologie“ und der berühmte Biologe Francisco Varela hat diese begründet. Er sagt: „Jede Wissenschaft von Geist und Bewusstsein muss früher oder später mit der Grundbedingung zurechtkommen, dass wir keine Ahnung davon haben, was das Mentale oder Kognitive überhaupt sind, außer dass wir es selbst erleben.“ (Übersetzung BL) Psychologie und Kognitionswissenschaften brauchen also notwendig die Perspektive der persönlichen und subjektiven Erfahrung um voranzukommen. Diese wird klassischerweise als Erste-Person-Perspektive bezeichnet, die nun systematisch mit einer forschungstypischen Dritte-Person-Perspektive verknüpft werden soll.
Varietäten des Selbst
Bevor er das vertiefen wird, möchte Herr Trautwein noch einige Informationen vorausschicken. Es geht um das Verständnis dessen, was wir unter „Selbst“ verstehen wollen. Zwei Richtungen sind bekannt, deren eine das narrative/konzeptuelle/reflektive Selbst genannt werden könnte. Es verfügt über autobiografisches Wissen, ein Selbstkonzept und besitzt eine soziale Identität – es nimmt sich selbst zum Objekt.
Die andere Richtung bringt ein verkörpertes/minimales/präreflexives Selbst ans Licht. Es ist mit dem Körper identifiziert, ist das handelnde Selbst, verfügt über Selbstlokalisation und besitzt eine Ich-Perspektive, das direkten Zugang zu den basalen Körpergefühlen hat. Es ist das Selbst als Subjekt.
Selbst als Objekt
Es gibt bereits zahlreiche empirische Befunde zum narrativen Selbst. Es ist mit Aktivität im sog. „Default Mode Network“ assoziiert. Das sind Gehirnbereiche, die aktiv sind, wenn wir uns gerade mit nichts Besonderem befassen. Fast fünfzig Prozent der Zeit verbringen wir mit dieser „Fokussierung kognitiver Prozesse auf selbst-relevante Inhalte“. Selbstrelevant ist, wenn wir uns selbst Aufmerksamkeit schenken, unser Gedächtnis nutzen oder uns selbst ein wenig rosiger sehen, als wir es tatsächlich sind. Das ist wichtig für die Selbstwertregulation, so dass das Selbst schon einmal als „verzerrtes kognitives Konstrukt“ bezeichnet wurde. Es spricht einiges dafür, dass dies notwendig für ein gesundes, integriertes und selbstwirksames Ich ist.
Selbst als Subjekt
Es gibt inzwischen eine zunehmende empirische Forschung zum verkörperten Selbst. Das ist naturgemäß schwieriger als bildgebende Verfahren, hält sich dieses subjektive Selbst doch eher im Hintergrund der Erfahrungen auf. Bereits im Eröffnungsvortrag von Herrn Metzinger wurden die Forschungssettings mithilfe von virtuellen Realitäten dargestellt.
Ein weiterer Zugang stellt die Hypothese dar, dass das verkörperte und handelnde Selbst ein Produkt der Eigenaktivität des Organismus sein könnte. Da der Organismus ohnehin ständig in Interaktion mit seiner Umwelt ist, wirkt diese auf die Regulation des Körpers. Dies wiederum stößt eine Selbstregulation der Kognition an.
Veränderte Bewusstseinszustände
Veränderte Bewusstseinszustände könnten eine Möglichkeit bieten das Phänomen des Selbst besser zu verstehen. Damit kommt die Frage auf, ob es eine Art von „Selbstspezifität“ eine exklusive und nicht-kontingente Eigenschaft des Selbst geben kann. Welche Art von Wahrnehmung ist noch mit dem Selbst verbunden und dann stellt sich schnell heraus, dass das konzeptionelle Selbst (Narration) nicht notwendig für ein Selbstgefühl ist. Die Frage, ob auch auf das verkörperte Selbst verzichtet werden kann, ist Gegenstand derzeitiger Forschung. Gesucht wird das ‚Minimale Phänomenale Erleben‘.
Um diesem MPE auf die Spur zu kommen bietet sich Meditation an. Hierbei könnten erfahrene Meditierende behilflich sein, die mit den veränderten Bewusstseinszuständen sehr vertraut sind.
Meditation
Was für Meditationen gibt es überhaupt? Kann man eine einheitliche Definition geben? Eine Formulierung könnte lauten: Praktiken, die Körper und Geist selbst regulieren, die durch spezielle Aufmerksamkeit geistige Ereignisse hervorrufen. Dies ist allerdings einigermaßen unscharf und so fokussiert sich die Forschung auf ‚Achtsamkeitsmeditation‘.
Es geht dabei um Aufmerksamkeitsregulation – das Meta-Gewahrsein der gegenwärtigen Erfahrung. Die affektive Haltung besteht dabei aus Offenheit, Neugierde, Akzeptanz
Eine weitere Betrachtung sind Familienähnlichkeiten von Praktiken. Da finden sich eher fokussierte oder eher offene Arten der Aufmerksamkeit. Dann gibt es die Meditationen, prosoziale Werte und Gefühle adressieren – konstruktiv genannt und dekonstruktiv wären Meditationen, die Zusammenhänge, die gesehen werden, auflösen können.
Meditierende
Meditation findet eine zunehmende Verbreitung – 11 % der Befragten geben an täglich zu meditieren. 79 % haben schon einmal Meditation erprobt.
Die positive Wirkung auf Gesundheit und Wohlbefinden ist gut etabliert, so gibt es eine klinische Studie, die moderate Evidenz für Reduktion von Ängsten, Depressionen, chronische Schmerzen, Sorgen und verbesserte Lebensqualität zeigt.
Bei einer weiteren Studie wurde bei einer gesunden Population große Effekte auf Stress und moderate auf Angst Depression zeigt, sowie ebenfalls eine verbesserte Lebensqualität.
Aktuelle Forschungsfragen drehen sich darum, was bei fortgeschrittenen meditativen Praktiken und tiefen Meditationszuständen hinzukommen mag. Ganz grundsätzlich wird nach Modellen und Mechanismen gesucht, die erklären können, wie durch die im Grunde genommen simple Praxis der Meditation solche eindrucksvollen Effekte entstehen können.
In den Blick kommen auch Nebenwirkungen, also unangenehme Veränderungen im Selbsterleben und der Versuch, die entsprechenden neuronalen Prozesse zu verstehen.
Meditation und Selbsterleben
Eine sehr alte Tradition der Meditation stammt von Buddha bzw. dem Buddhismus. Für diesen spielt die Entstehung von Leid eine zentrale Rolle und eine wichtige Quelle von Leid ist die fehlgeleitete Sicht auf das Selbst. Mediation ist die Möglichkeit, dies zu verändern. Dazu noch ein Zitat: „Den Weg zu studieren, heißt das Selbst zu studieren. Das Selbst zu studieren heißt das Selbst zu vergessen. Das Selbst zu vergessen heißt von allen Dingen des Universums erleuchtet zu werden.“ Dieser kurze Ausflug in die Spiritualität soll genügen, stiftet aber den Übergang zur neuzeitlichen Forschung. Diese hat herausgefunden, dass das „Decentering“ ~ Desidentifikation eine hilfreiche Wirkung in der achtsamkeitsbasierten Depressionstherapie hat.
Als Beispiel bekommen wir eine kleine Grafik. Diese beginnt mit einer Wahrnehmung/Gedanken, dem eine Identifikation folgt, der wiederum eine Reaktivität folgt. Der Gedanke könnte sein: Das war ein Fehler und die sich daraufsetzende Identifikation könnte lauten: Nichts gelingt mir. Woraufhin die Reaktivität mit Traurigkeit und Hilflosigkeit reagiert. Mit der Fähigkeit des Meta-Gewahrseins ist es möglich, den Gedanken zu erkennen >>nichts gelingt mir<< und sich von diesem Gedanken zu desidentifizieren und damit auch neue Reaktionen zu ermöglichen.
Empirische Forschung: Effekte auf den narrativen/konzeptuellen Ebene
Diese Praxis ermöglicht den Meditierenden, sich weniger mit sich selbst zu beschäftigen, was sich z. B. darin zeigt, dass das Default Mode Network weniger aktiv ist. Auch andere Versuchssettings mit erfahrenen Meditierenden bestätigen diesen Effekt.
Gibt es auch Effekte auf das verkörperte/minimale Selbst?
Dazu stellt uns Herr Trautwein eine qualitative Forschung an Langzeitpraktizierenden vor. Von diesen berichteten 75 % von aversiven Erlebnissen. Sie schilderten intensive Veränderungen im Selbsterleben z. B. Verlust von Selbst-Welt Grenze. Dieser Effekt ist gut bekannt. Schon kurze Achtsamkeitsübungen z. B. ein Body-Scan können zu diffuserem Erleben der Körpergrenzen führen.
Wie sehen nun die Phänomenologie und die neuronalen Prozesse des veränderten Selbsterlebens bei intensiver Praxis aus?
Bei einer Studie in Israel wurden Interviews und verschiedenste Untersuchungen mit einem sehr erfahrenen Meditationslehrer durchgeführt. Er berichtete von einem graduellen Prozess der Auflösung der Selbst-Welt Grenze. Dies korrelierte mit einer reduzierten Beta-Aktivität in bestimmten Gehirnregionen.
Anschließend wurde versucht, ob dieses Ergebnis replizierbar und generalisierbar in einer größeren Stichprobe wäre. Die Probanden erhielten den Auftrag, sich abwechselnd ihres Körperselbst bewusst zu bleiben (Agency) und dann die Kontrolle loszulassen und in die Entgrenzung zu wechseln und das mehrere Male. Alle Proband*innen wurden gescannt und danach interviewt. Sowohl die Scanner Aufnahmen als auch die Interviews ergaben ähnliche Ergebnisse wie erwartet. Neurophysiologisch ist ein deutlicher Unterschied zwischen Entgrenzung und Agency wahrnehmbar.
Herr Trautwein kommt zu einem Fazit:
Die innere Distanzierung von Aspekten des narrativen/konzeptuellen Selbst ist ein grundlegender Prozess in der Achtsamkeitsmeditation.
Auch das verkörperter Selbst wird durch Meditation beeinflusst
Diffusere Köper-Welt-Grenzen entstehen schon nach einer kurzen Achtsamkeitsübung.
Auflösung der Selbstwahrnehmung als räumlich verkörpertes, mit der Welt interagierendes Subjekt in Meditationszuständen fortgeschrittener Meditierender
Dies geht einher mit reduzierter Aktivität in sensomotorischen Arealen sowie (bei umfassenden Entgrenzungserfahrungen) im posterioren medialen Cortex
Das bedeutet:
-> empirische Evidenz für das Selbst als dynamischen (en-)aktiven Prozess, welcher durch (mentale) Handlung hervorgebracht wird
-> der Einbezug der Erste-Person-Perspektive kann zum Verständnis des Gehirns beitragen
Damit begründet Herr Trautwein, dass „das Selbst ein dynamischer und aktiver oder enaktiver Prozess ist, also ein Prozess, der sich quasi aus seiner eigenen Aktivität hervorbringt. Das heißt, das Selbst entsteht durch die mentale Handlung, auch durch die körperliche Handlung und Interaktion mit der Welt und ist quasi ein Prozess, der ständig immer wieder hervorgebracht wird.“
Auf einer methodischen Ebene sind diese Ergebnisse ein Stück weit eine Bestätigung für die Idee, dass der Einbezug der ersten Person Perspektive die empirische Forschung ergänzen und bereichern kann.
Implikationen
Meditationen haben also einen Einfluss auf die Befindlichkeit. Dies trifft auf einen Zeitgeist, in dem unerwünschte Nebenwirkungen von Meditation bekannt werden. Die Frage bleibt, was ist erwünscht und was nicht?
- Nebenwirkungen von Meditation durch unerwünschte Veränderungen im Selbsterleben
- Veränderungen im Selbsterleben als Wirkmechanismus von Meditation?
Je nachdem wen man wie fragt, kommen die Forscher zu unterschiedlichen Ergebnissen. Bekannt ist die qualitative Erfassung an Personen mit belastenden Meditationserfahrungen. Es gibt Befragungen, die über diverse z. T. stark belastende Erfahrungen in verschiedenen Bereichen berichten – kognitiv, perzeptuell, affektiv, somatisch, sozial und im Selbsterleben. Bei 73 % moderate bis schwer, anhalten Beeinträchtigung, bei 17 % Hospitalisierung – Zahlen, die lt. Herrn Trautwein mit Vorsicht zu betrachten sind.
Denn, bei diesen erlebten Veränderungen im Selbsterleben müssen Überlappungen mit Psychopathologien berücksichtigt werden, also differenzialdiagnostische Erwägungen getroffen werden.
Die seriösere Erfassung in repräsentativen Stichproben berichten von 30 -50 % unerwünschten Nebenwirkungen wie Ängste, traumatische Erinnerungen und emotionale Sensitivität.
Bei 10 % ergaben sich dadurch funktionelle Beeinträchtigung, die zeitlich begrenzt auf kürzer als eine Woche waren.
Bei belastenden Kindheitserlebnissen wird das häufiger erlebt. Der wahrgenommene Nutzen war aber davon unabhängig.
Herr Trautwein folgert daraus:
-> die Notwendigkeit systematischer Forschung: Personen- und Kontextfaktoren? Kausalität?
-> eine Qualitätssicherung in der Ausbildung in angebotenen Gesundheitsprogrammen und Interventionen
Es bleiben offene Fragen. Z.B. ob die Veränderungen im Selbsterleben ein Wirkmechanismus von Meditation sind? Oder ob Selbsttranszendenz als transdiagnostischer Prozess betrachtet werden kann?
Ein spannender und informativer Vortrag: