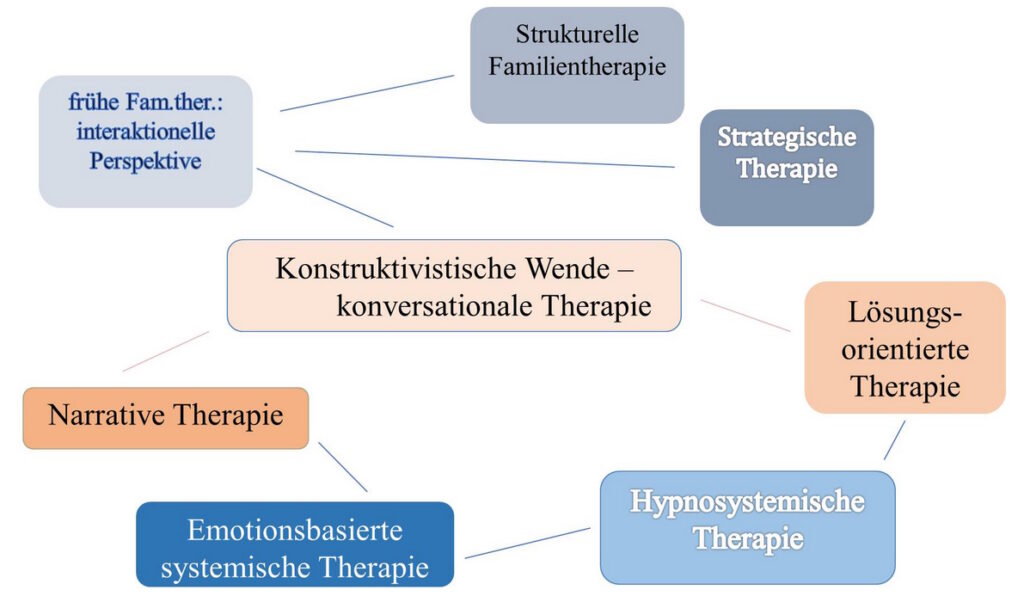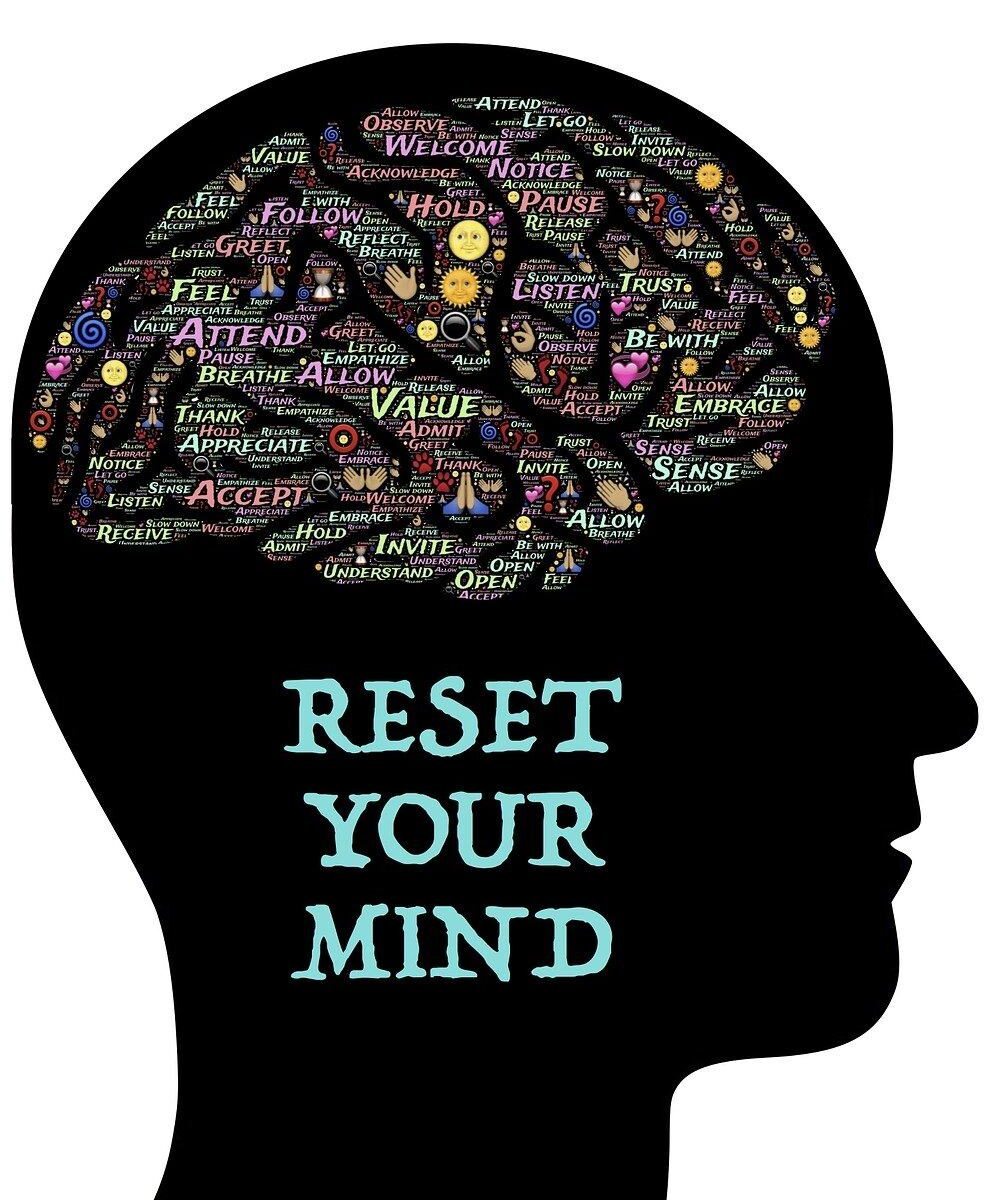Bericht vom 14.11.23 Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Dr. Natalie Knapp Gründungsmitglied des Berufsverbands für Philosophische Praxis, Philosophin, Autorin, Rednerin, Berlin: „Gedankliche Dehnübungen – Über Spiritualität und ihre Bedeutung im 21. Jahrhundert“
Frau Knapp stellt uns die drei Fragen vor, mit denen Sie ihr selbstgewähltes Thema strukturiert hat.
1. Was bedeutet Spiritualität im 21. Jahrhundert?
2. Vor welchen Herausforderungen steht die Spiritualität im 21. Jahrhundert?
3. Was könnte uns helfen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden?
Verständnis von Spiritualität im 21. Jahrhundert
Sie berichtet davon, dass sie als junge Frau den Text von F. Nietzsche gelesen hat. Es war der tolle Mensch, der aussagt: „Gott ist tot, wir Menschen haben in umgebracht.“ Diese Worte haben Frau Knapp nachhaltig erschüttert.
Um zu illustrieren, was der Text angestoßen hat, zeigt sie nun zwei Bilder von Caspar David Friedrich. Die berühmten Werke, „der Wanderer über dem Nebelmeer“ und „der Mönch am Meer“. Sie begründet die Wahl dieser Bilder, weil die Künstlerin Jule Wanders diese für eines ihrer Anti-Selfies genutzt hat. Für ein Anti-Selfie legt sich Frau Wanders bäuchlings vor ein Gemälde und lässt sich so, samt Gemälde fotografieren.
Frau Knapp deutet das zum einen als Betonung des Bildes anstatt der Selbstabbildung, zum anderen sieht sie in der Körperhaltung die Unterwerfungsgeste, wie sie z. B. auch im tibetischen Buddhismus praktiziert wird.
Wir erfahren noch, dass C.D. Friedrich den Mönch am Meer schuf, als er um seine geliebte Schwester trauerte, die kurz zuvor gestorben war. Abgebildet sind Meer, Strand, Himmel und ein Mensch in dieser grenzenlosen und unfassbaren Weite.
Das führt zu ihrer Antwort auf ihre erste Frage. Da es so viele Versuche gibt, Spiritualität zu definieren, erlaubt sie sich, eine eigene Definition einzuführen.
„Spiritualität bedeutet, sich mit der größtmöglichen, erfahrbaren Dimension angemessen ins Verhältnis zu setzen, ihr einen Ausdruck zu geben und dafür Verantwortung zu übernehmen.“
Spiritualität ist ihrer Ansicht nach eine Haltung und eine Praxis. Sie erinnert uns daran, dass es sich sehr unangenehm anfühlen kann, an den Grenzen des eigenen Horizonts zu stehen und das Übermächtige jenseits dieser Grenzen ertragen zu können. Der Lebenshorizont endet beim Tod, aber auch bei der Liebe. Darüber hinaus gibt es gewaltige Naturkräfte wie Sturmflut, Pandemie u. v. m. Der übliche Versuch, solche Übermächte wegzudefinieren, ist nicht immer erfolgreich.
So sieht sie die Kunstform des „Anti-Selfies“ auch als einen Versuch, sich diesen übermächtigen Lebensdimensionen zu stellen. Gerade in der Moderne, in der die Individualität mit dem Selfie auf die Spitze getrieben wird, braucht es so etwas wie eine Rückbesinnung auf andere Qualitäten.
Die Herausforderungen an die Spiritualität im 21. Jahrhundert
Das aktuelle Zeitgeschehen bietet eine Anschauung zum Umgang mit dem Schrecklichen. Der Überfall auf Israel am 07. Oktober wurde u. a. von Yuval Noah Harari kommentiert. Dieser Welthistoriker praktiziert seit vielen Jahren Meditation. In seinem Zitat geht es sinngemäß darum, dass dieser erbitterte Kampf keinen Raum dafür lässt, den Schmerz der jeweils anderen Seite anzuerkennen. Das ist auch eine Chance für außenstehende Menschen, denn diese sind in der Lage, den Schmerz beider Seiten zu sehen. Sie können eine übergreifen Perspektive einnehmen und den Blick auf den wünschenswerten Frieden richten. Diese Perspektive auf das Große, das sei ebenfalls Spiritualität, so Frau Knapp.
Wir bekommen die Anregung, uns an einen friedlichen, vielleicht glücklichen Moment unseres Lebens zu erinnern und verbunden mit dieser Erinnerung unseren Körper spüren. Natürlich entspannt sich der Körper, der Atem vertieft sich, der innere Raum weitet sich. Und ganz am Rand der Wahrnehmung findet sich dann eine Spur von Glück. Dieses Glück ist wie ein durchscheinendes Leuchten, sanft und friedlich, fern von Gleichgültigkeit.
Auf dieser Basis möchte sie verdeutlichen, dass Frieden mehr braucht als Entwaffnung. Frieden braucht ein offenes Herz, einen Raum, in dem ehemalige Feinde miteinander leben können. Diesen Friedensraum zu kultivieren, betrachtet sie als die spirituelle Aufgabe des 21. Jahrhunderts – trotz und in den Katastrophen einen Raum in sich zu schaffen und zu pflegen.
Frau Knapp blickt nun in die Vergangenheit. Sie erinnert uns an die Zeiten als noch Kirchen den ärmlich lebenden Menschen eine Ahnung von Größe und Weite boten. Die gewaltigen Räume mit ihren bunten Fenstern boten das Abbild einer heiligen Architektur. Darin konnten sich die Menschen aufgehoben fühlen. Aufgehoben ganz im Hegelschen Sinn verstanden als bewahrt, erhöht und entmächtigt.
Heutzutage sind die großen Räume Konsumtempel geworden. Ganz und gar diesseitig und ohne jegliche Tendenz, dieses Diesseits zu transzendieren. Zu Beginn war die Natur selbst der Raum und erst mit der Sesshaftwerdung entstanden die sakralen Räume und mit ihnen die Institutionen mit ihrer Macht, die sie leider allzu oft auch missbraucht haben und missbrauchen. Seither wächst das Misstrauen gegen die größeren Dimensionen und die Entstehung und der Glaube an die Individualität rückt an die erste Stelle.
Noch weiter zurück in der Geschichte landen wir in der Steinzeit. In einer Höhle befinden sich Menschen und draußen toben die elementaren Kräfte – Sturm, Regen, Blitz und Donner. In dieser Zeit schuf ein Mensch die Figur der Venus von Hohenfels. Wozu? Warum wurde diese und andere Figuren geschaffen? Als Abbild und zur Ehre der nährenden, lustvollen, gebärenden Natur? Als Anrufung einer Verbündeten oder als Ansprechpartnerin?
Frau Knapp erinnert sich an einen Spaziergang am Meer. Es war während eines Sturms und er wäre ihr fast zum Verhängnis geworden. Sie hatte damals die gewaltigen Naturkräfte unterschätzt. Diese Erinnerung führt sie zum gegenwärtigen verniedlichenden Sprachgebrauch im Angesicht der sog. Klimakrise. Die Kräfte, die hier bereits am Werk sind, werden alles übertreffen, was Menschen jemals erlebt haben.
Sie empfiehlt uns zum Thema das Buch „Wasser und Zeit“ von Andri Snær Magnason. Er schreibt, dass das Wort Klimawandel wie ein Rauschen sei, um etwas zu sagen, zu dem was passiert. Das Gehirn könne das Ausmaß nicht erfassen. Jegliche Bedeutung werde aufgesaugt.
Darin sieht sie die spirituelle Aufgabe der Menschen im 21. Jahrhundert. Der Umgang und die Erfahrung in und mit der Klimakrise (Katastrophe). Worin bestehen diese besonderen Herausforderungen? Sie erzählt von einem Gespräch einer Urgroßmutter mit ihrer Urenkelin und die beiden rechnen aus, dass die Erinnerungen, die diese Urgroßmutter an ihre Urenkelin weitergibt, von der Urenkelin dann wiederum an ihre Urenkelin weitergeben kann, wenn sie dereinst selbst zur Urgroßmutter geworden sein wird. Diese persönlichen Erinnerungen können auf diese Art über 260 Jahre erhalten bleiben und weitergegeben werden. Eine Erinnerungskultur also – Erinnerung an die Zeiten, als die Erde noch eine freundlichere Heimat war.
Diese neue und unfreundlichere Erde verstärkt das Gefühl der Solastalgie – den Schmerz über den Verlust der Heimat und des Vertrauten.
Sie schildert dieses Gefühl aus der Körperempfindung. Aus der Verbindung, die der Körper mit seiner Heimat hat – eine Verbindung mit der Erde, den Lebewesen und den Gerüchen, mit denen er aufgewachsen ist. Und dann? Keine vertrauten Vogelstimmen mehr, nicht mehr die bekannten Pflanzen und keine vertrauten sinnlichen Erfahrungen mehr. Wenn das alles weg ist, entsteht Schmerz. Und dieser Schmerz kann in eine spirituelle Krise führen, so Frau Knapp.
Wie kann uns Spiritualität in der Zukunft helfen?
Aus dieser Krise werden die nächsten Generationen durch spirituelle Praktiken herauskommen können, erwartet Frau Knapp. Sie werden sich mit der Erde rückverbinden, mehr gärtnern und die Natur achten.
Spiritualität ist nicht nur etwas Geistiges. Sie ist die Verbindung von Sichtbarem und Unsichtbarem. Zum Beispiel in der Sprache. Aus 24 Buchstaben entstehen unendlich viele Bedeutungen – ein Wort wird gesprochen oder geschrieben, sichtbar oder hörbar. Beim Leser oder Hörer entsteht unsichtbar der Sinn und die Bedeutung der Worte. Und diese Worte führen uns bis tief in unsere Körperempfindungen hinein. „Ein bestirnter Nachthimmel in einer klaren Winternacht.“ Wer verspürt nicht ein gewisses Erschauern beim Hören/Lesen dieser Worte. Die Möglichkeit der Symbolisierung ist ein quasi magisches Handeln. Es ermöglicht und erschafft die Verbindung zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren.
So auch die Symbole für das, was den Einzelnen unendlich übersteigt – die Biosphäre, die Atmosphäre, die Ökosphäre. Über den Atem sind wir mit all dem verbunden. Wir sind ein Teil davon und sie ist ein Teil von uns. Das besagt bereits das Wort „Spiritualität“, denn es leitet sich von „Spiro“ Atmen ab. Im bewussten Atmen können wir uns der Kräfte bewusstwerden, zu denen wir uns verhalten müssen.
Frau Knapp differenziert zwischen Religion und Spiritualität. Sie hält Spiritualität für offener und freier. Kein Priester schreibt vor, zu wem, wann, wie gebetet oder geopfert werden soll. Die Freiheit der Spiritualität bringt natürlich Verantwortung mit sich. Die spirituelle Haltung und Praxis will gepflegt werden, was ein Pflicht mit sich bringt – nur so kann sie wirksam werden.
Spirituelle Praxis kann aus atmen bestehen, aus sitzen, tanzen oder singen. Alles, was uns hilft einen Zugang zu den uns übersteigenden Dimensionen zu finden ist möglich und am besten geht das in einer Gemeinschaft.
Eine andere Möglichkeit wäre die Beschäftigung mit Kunst jeglicher Art. Sie berichtet von ihrer Freundin, die unter chronischen Schmerzen leidet. Aber wenn sie Mozart hört und sich der Musik hingeben kann, dann verschwindet der Schmerz aus ihrem Bewusstsein.
Frau Knapp fasst die Antworten auf ihre drei Fragen noch einmal kurz zusammen. Sie erinnert an ihre Definition von Spiritualität. Daran, dass im 21. Jahrhundert überwiegend selbstbezogene Individuen übermächtigen Elementen gegenüberstehen, deren Sprache scheinbar nicht verstanden wird. Und drittens die Aufforderung, aus unserem spirituellen Autismus herauszukommen, wieder Beziehungen zum Unsichtbaren aufzunehmen und eine spirituelle Praxis, die uns liegt, aufzunehmen.
Sie ermutigt uns, die Realität wahrzunehmen, wie sie erscheint und nicht zu versuchen, sie wegzudefinieren.
Frau Knapp erhält ausdauernden Applaus, aber leider wurde der berührende Vortrag nicht aufgezeichnet.