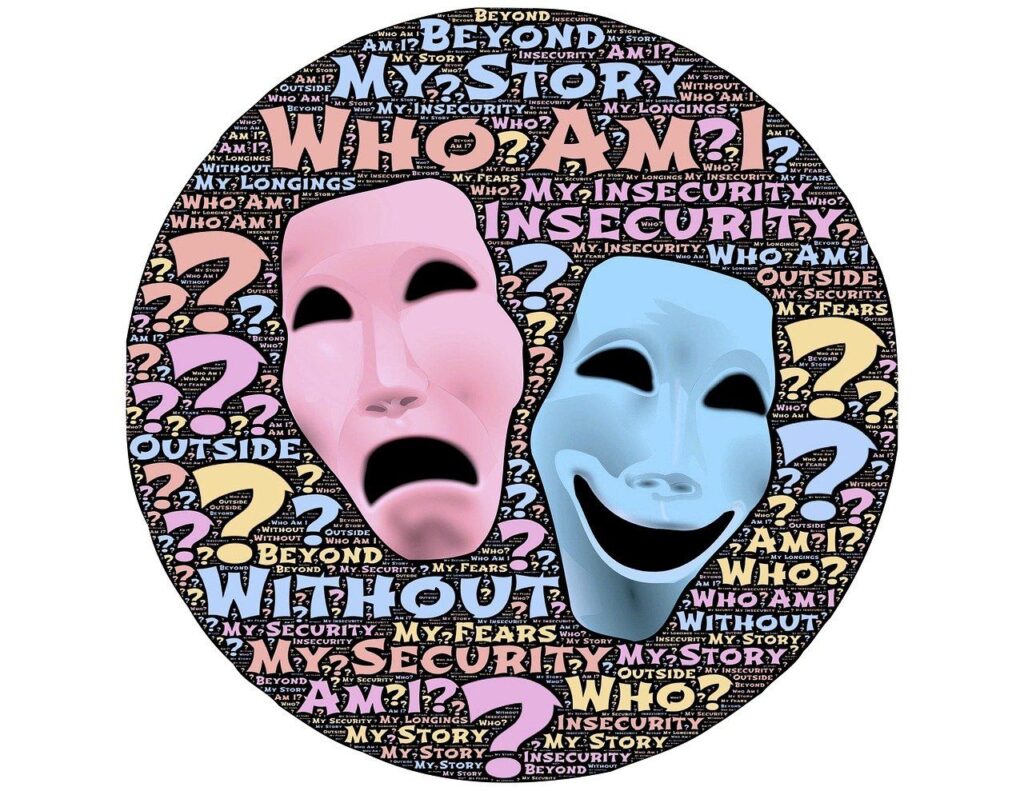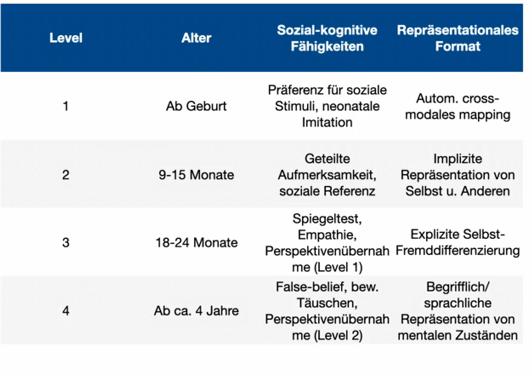Die Szene der Körperpsychotherapie in Deutschland hat ein neues Format für ein Treffen ausprobiert. Anstatt eines Kongresses wurde ein Festival anberaumt. Im großen Yoga-Ashram in Bad Meinberg trafen sich viele Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland und Europa. Ich hatte das große Vergnügen, daran teilzunehmen.
Am Anreisetag abends eröffnet Marc Rackelmann das Festival und gibt uns, unterstützt von Stefan Ide und Kathrin Stauffer einen kleinen Überblick über die Geschichte der KPT. Natürlich ist Wilhelm Reich dabei und Menschen wie Alexander Lowen, Gerda Boysen und natürlich David Boadella. Jeder Name wird durch eine kleine Erfahrung ergänzt, die für den/die Therapeut*in typisch ist. Unseligerweise wurde diese Präsentation durch einen Feueralarm vorzeitig beendet.
In der Pause bis zum Abendessen erkunde ich ein wenig das riesige Gelände und versuche, Orientierung zu finden. Es gibt zahlreich Räume für die Workshops und eine neue Idee sog. „Soma-Corners“. Gelegenheiten sich über Themen zu unterhalten wie: Wie arbeiten Therapeuten in Bulgarien/Kosovo/Italien/Deutschland? Was bedrückt mich gerade am meisten? Der schlechteste Therapeut überhaupt … An jedem Festivaltag wurde je drei solcher Soma-Corners angeboten.
Kulinarisch war ich sehr herausgefordert, denn natürlich ist die Küche im Ashram rein vegan und ebenso gibt es ein vollständiges Alkoholverbot. Ich habe mich dieser Herausforderung gestellt und souverän gemeistert.
Der Abend endete mit einer Runde „Ecstatic Dance“. Ich fand für mich leider nicht in die Ekstase, aber sehr viele der Kolleg*innen hatten große und lautstarke Freude.
Tag 2
Das Programm des zweiten Tags begann mit einem Vortrag von Maurizio Stupiggia mit dem Titel: „From Grounding to Homing-in. Cross-Cultural Pathways of the Emotional Body“. Maurizio ist im Verlauf seiner Karriere weit in der Welt herumgekommen. Insbesondere in Japan und Brasilien hat er viele Erfahrungen gesammelt.
Er berichtet über die Irritationen, die er mit seinen Vorstellungen von z.B. emotionalen Ausdrucksbewegungen, die traditionell in der KPT und in Europa als positiv und gesund betrachtet werden, in Japan allerdings ein ganz anderes Echo finden. Dort steht die soziale Harmonie im Vordergrund und dort werden die Mitmenschen eher nicht mit Emotionen belastet. Auf den ersten Blick unverständlich und leicht pathologisierend, hat er im Laufe der Zeit gelernt, diese kulturelle Differenz auch wertzuschätzen. Er macht daran den Unterschied von Grounding (Erdung) und Homing-in (~Einwohnen) deutlich. Geerdet ist die Anerkennung und der Umgang mit der umgebenden Realität, Homing-in hat etwas mit Heimat, Daheim-sein zu tun. Es ist die Qualität der Vertrautheit und Sicherheit, des Aufgehoben-seins mit anderen.
Ähnliche Erfahrungen hat er in Brasilien gemacht. Ähnlich insoweit, dass er auch dort einen ganz anderen Umgang mit Gefühlen kennengelernt hat. Insbesondere das Leid und der Schmerz wird dort über gemeinsamen Gesang ausgedrückt. Dazu zeigt er uns noch einen kurzen Film über einen Migranten, der darüber singt, wie er aus seiner Heimat vertrieben wurde, in der Wüste viele Freunde verloren hat, in der Fremde verfolgt wurde und wie er schließlich als einer von wenigen auch die Überfahrt übers Meer überlebt hat. Ein erschütterndes Zeugnis.
Nach einer kurzen Pause folgt Alexandra Algafari mit ihrem Beitrag: „OK, Boomer … Let us all breathe through that: Generational Differences in Body Psychotherapy“. Sie zeigt uns zunächst die Folge der Generationen: Baby Boomer (1946 – 1964): Aufgewachsen in einer Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs und sozialen Wandels; geprägt von politischem Aktivismus, Optimismus und einem starken Einfluss auf die Popkultur. Boomer sind noch mit dem Wiederaufbau beschäftigt v.a. in Deutschland.
Generation X (1965 – 1980): Geboren zwischen den Boomern und den Millennials, bekannt für ihre Anpassungsfähigkeit, Unabhängigkeit und ihre Erfahrungen mit dem Aufkommen der Technologie. Sie sind auch als Schlüsselkinder bekannt geworden. Sie sind sehr selbstständig, haben es aber schwer, ihre Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken.
Generation Y / Millennials (1981 – 1994): Erste Generation, die in der digitalen Ära aufwuchs; geprägt von Technologie, einem starken Fokus auf Individualität, Flexibilität und einer wachsenden Bedeutung von sozialen Medien. Das ist die Generation der Hetze, Eile und der Schnelligkeit.
Generation Z (1995 – 2009): Aufgewachsen mit moderner Technologie, häufig als die ersten digital natives bezeichnet; vielfältig, global vernetzt und engagiert für soziale Gerechtigkeit und Umweltfragen. Hier kommen gänzlich andere Werte ins Spiel, die ein Boomer wie ich kaum nachvollziehen kann.
Generation Alpha (ab 2010): Geboren in einer Zeit des technologischen Fortschritts, geprägt von digitaler Kompetenz, einer diversen Gesellschaft und einem Potenzial für zukünftige Innovationen. Es ist noch etwas zu früh, über diese Generation zu sagen.
Natürlich ist das alles sehr holzschnittartig, aber es gibt einen Eindruck, wie das Lebensalter mit Werten und Erfahrungen zusammenhängt, die dann in der Therapie sehr relevant werden können. Die Herausforderung und Aufforderung, die bei diesem Festival fast ständig zu hören ist, lautet, offen und neugierig zu bleiben.
Workshops
Nach der Kaffeepause (der Kaffee wurde extra für das Festival zubereitet) suche ich mir einen Workshop aus. Workshop aussuchen, war für die Veranstalter ein Lernfeld. Ca. 300-400 Teilnehmer*innen sollen sich am Tag vor dem Workshop entscheiden, was sie besuchen wollen. Das gab einen enormen Andrang und die letzten mussten nehmen was übrigblieb.
Ich besuchte den Workshop von Iva Hristova: „Listen! Your body has something to tell you“. In einem schönen Raum stellte uns Iva ihr Projekt vor. Elemente der Tanztherapie verbunden mit einem Stein und einem Duftöl, das ich auf Wunsch auf meinen Handrücken bekam. Dann folgte eine zunächst geführte Körperreise in eine Form von Selbstverbindung, ähnlich dem Authetic Movement oder auch dem Butoh Tanz, in dem ich meine Körperimpulse wahrnehmen, erforschen und zum Ausdruck verhelfen durfte. Und tatsächlich erlebte ich einen sehr schönen, sehr tiefen Prozess. Ein Tanz auf dem Boden, liegend den Raum um mich herum erforschend. Also ging ich gut zentriert und geerdet in die kurze Mittagspause.
Danach wählte ich Federica Raso mit ihrem Angebot: „Connecting with your strength“. Federica erläuterte kurz den Hintergrund ihrer Arbeit mit Bioenergetik und Playfight. Sie warnte uns vor, dass der Workshop sehr dynamisch werden würde und das wurde er auch. Eine Reihe von Aufwärmübungen alleine und mit Partnern brachte alle Teilnehmer*innen in Stimmung für den „Fight“. Dazu hatte sie Matratzen ausgelegt. Die Spielregeln waren einfach. Wer kämpfen will, kämpft auf den Knien, er kann sich verschieden Vorbedingungen erbitten – z.B. kämpfen als wenn ich verletzt wäre oder einfach kämpfen. Natürlich sind Schläge und gefährliche Techniken verboten. Beide Schultern auf dem Boden ergibt eine Unterbrechung und der Zeitraum beträgt vier Minuten. Anschließen würdigen sich die Gegner*innen gegenseitig und erhalten auch Wertschätzung von der Gruppe.
Dann begannen etliche Kämpfe – Mann gegen Mann, Frau gegen Frau und Mann gegen Frau, jung gegen alt, schwer gegen leicht, kräftig gegen weniger kräftig. Es waren viele schöne Begegnungen, in den Entschlossenheit, Kampfgeist, Anmut u.v.m. zu bezeugen war.
Schließlich ging es in ein Gruppenspiel mit fließenden Übergängen – jeder durfte sich ein- aus auswechseln. Eine schöne Gelegenheit, auch für mich, mich mal wieder auf ein Kämpfchen einzulassen – es hat mir viel Spaß gemacht.
Vortrag und Interview
Nach der Pause sahen wir zunächst ein Video, in dem Stephen Porges uns seine „Polyvagale Theorie“ vorstellte. Diese ist insbesondere bei Trauma-Therapeut*innen sehr populär und beliebt, da sie auf plausible Art traumatisches Erleben und die heilsame Wirkung von „Vagus-Stimulation“ durch Mitmenschen begründen kann. Die Theorie an sich hat durchaus Kritiker und wird von einigen Fachlauten eher skeptisch eingeschätzt. Danach wurde Stephen Porges auch befragt als er dann live zugeschaltet wurde. Er relativierte die Kritik und verwies auf die erfolgreiche Arbeit, die seiner Ansicht nach mithilfe der Theorie getan wird. Ich werde mich bei Gelegenheit noch einmal intensiver damit befassen.
Nach diesem Vortrag und der Diskussion war ich so müde, dass ich auf die Soma-Corners und die Silent-Disco verzichtet habe und sehr früh ins Bett ging.
Tag 3
Der nächste Morgen begann mit einem weiteren Vortrag. Die Referentin war Merete Holm Brantbjerg und der Titel des Vortrags lautete: „Curious about what can go missing in stress and trauma?“ Das Phänomen der Übererregung im Zusammenhang mit traumatischen Erfahrungen ist gut bekannt. Aber was ebenfalls häufig vorkommt ist ein „Shut Down“, das Herunterfahren aller Systeme um zu überleben. Dieser Shut-Down kann das ganze System betreffen oder auch nur Teile davon. Stille breitet sich, Bewegungen kommen zum Erliegen, die Atmung wird flach und flacher. Häufig werden diese Anzeichen übersehen, weil es in anderen Körperbereichen gerade energetisch zugeht – die Augen sind weit aufgerissen, Hände öffnen und schließen sich, die Beine zittern … Merete ermahnt uns, auch auf die stillen Momente und Bereiche zu achten. Mit ihnen verbunden ist häufig Hoffnungslosigkeit und Selbstaufgabe. Sie ermutigt uns weiter sorgfältig dosiert in Intensität und Zeitaufwand mit stillen Bereichen Kontakt aufzunehmen. Die Bereiche zu identifizieren, in denen ein Muskel oder Klient insgesamt sich aufgegeben hat. Sie berichtet von vielen erfolgreichen Situationen, die sie so begleitet hat.
Nach der kurzen Pause betritt nun Matthew Appleton das Rednerpult. Er möchte uns etwas über: „The Matrix of Pre and Perinatal Trauma“ erzählen. Die Kongresssprache ist übrigens Englisch und überwiegend ein gut verständliches Englisch. Es gibt auch einen Übersetzungsdienst. Aber zurück zu Matthew. Er hat auch eine schöne Präsentation mitgebracht, mit deren Hilfe er seinen Input erläutert. Er betont, dass wir alle durch einen Geburtsprozess hindurchgegangen sind, und seine These ist, dass diese Erfahrung uns auch alle noch prägt – insbesondere in Übergangssituationen.
Aber zunächst berichtet er über seine Arbeit mit Babys oder besser gesagt „Schrei-Babys“ die selbst sehr belastet sind und ihre Eltern nicht selten an deren Grenzen bringen. Er unterscheidet hier das „Memory Crying“ – Weinen, weil der Geburtsprozess so schmerzhaft erinnert wird und Weinen aus Bedürftigkeit. Für letzteres wissen die meisten Mütter schnell, was zu tun ist.
Er erläutert uns im Schnelldurchgang vier Geburtsphasen. Phase 1 findet im Becken statt. Erfahrung von Druck, der sich bei Erwachsenen oft beim Beginn neuer Projekte wiederholt. Aber auch das „No Way out“ Gefühl, das manche Menschen in geschlossenen Räumen befällt. Gefühle von Hoffnungslosigkeit bis hin zur Depression können damit verbunden sein oder auch der Impuls, einfach hier raus zu müssen.
Die Stufe 2 findet in der Mitte des Beckens statt. Das Ungeborene muss sich nun drehen um in den Geburtskanal eindringen zu können. Matthew verbindet das mit Orientierungsverlust oder der Angst verloren zu gehen. Andererseits ist diese Phase auch assoziiert mit dem Vertrauen in die eigenen Instinkte. Weiter können Impulse auftauchen, die von einer Welt in eine andere wollen. Manche Menschen erleben sich zwischen Kopf und Herz gespalten. Auch Überzeugungen, sich immer falsch zu entscheiden, können mit dieser Phase verbunden sein.
Die Stufe 3 findet nun im Beckenausgang statt. Es geht darum, trotz Erschöpfung durchzuhalten oder eben aufzugeben. Ist es möglich, Schritt zu halten (mit den Wehen). Andere Erfahrungen können sich als die Erfahrung, gegen eine Mauer zu schlagen, zeigen. Oder auch Spekulationen darüber, wie es sein wird, wenn andere einen entdecken und sehen werden.
Die Stufe 4 ist schließlich die Ankunft in der neuen Welt. Hier kann eine Trennungsangst zurückbleiben. Die ersten Erfahrungen damit, wie ich angesehen werde – willkommen? Oder doch nicht so? Ist die Welt ein sicherer Ort? Sätze wie: „Ich muss schlecht sein, damit ich das verdiene.“ Können hier ihren Ursprung haben und zwischenmenschlich kann Berührungsangst und Rückzug hier mitgeboren worden sein.
Matthew beantwortet noch etliche Fragen auf sehr kompetente Art. Am Ende noch eine Statement, das ich von Herzen teile: „Trauma ist nicht das, was uns widerfahren ist, sondern das, was wir in uns tragen.“ Ich beschließe, nachher seinen Workshop zu besuchen.
Workshops
Aber vorher besuche ich „The embodied visceral Core-self – An Hands-on Session“ bei Siegfried Bach. Es wird eine kleine Wiederholung einiger bioenergetischer Übungen, einige sogar neu für mich und danach die Anleitung zu einer wohltuenden Tiefenentspannung – wirklich sehr erholsam, aber leider keine Hands-on.
Umso mehr freue ich mich jetzt auf Matthew, der seinem Workshop den Titel „The Birth-Story in the Body“ gegeben hat. Er möchte, dass wir nach dem Workshop Spuren der Geburt bei unseren Mitmenschen sehen können. Eine weitere kleine Präsentation erleichtert uns das Verständnis der schon im Vortrag genannten Geburtsphasen. Jetzt wird es aber sehr viel deutlicher wie anstrengend und fast schon gewalttätig eine Geburt sein kann. Gerade im Übergang von Phase zwei zu drei muss das Ungeborene eine sehr enge Stelle passieren, an dem nicht selten der Nasenknorpel sich vom Knochen löst. Manchmal verschieben sich die Schädelknochen so stark, dass einer unter den anderen gedrückt wird – bei Matthew war das der Fall. Es ist wieder ein sehr eindrücklicher Vortrag. Als Erfahrung bietet er uns an, dass wir mit einem Partner eine Beobachtungsübung machen. Einer betrachtet das Gesicht des Gegenübers und beschreibt, was er sieht. Wir bekommen dafür viel Zeit und die Übung ist intensiver, als sie sich vielleicht anhört. Das genaue Beobachten entfaltet nach und nach die Details im Gesicht des Gegenübers. Und die Schilderung meines Gesichts durch das Gegenüber ist irgendwie wohltuend für mich.
Matthew ermahnt uns, nett und neugierig zu uns und zu anderen zu sein. Die Asymmetrie in Gesicht und Körper anzunehmen und auch als Erinnerung an die Geburt zu betrachten und eben nicht als einen Makel, wie es so häufig der Fall ist.
Am späten Nachmittag biete ich dann selbst noch meinen Workshop an: „Raum – Grenze – Kontakt“ ist der Titel. Ich versammle immerhin sieben interessierte Interessent*innen und darf mit einer italienischen Kollegin demonstrieren, wie mein Teppich-Setting funktioniert. Die Erfahrung wird sehr positiv aufgenommen und ich freue mich sehr über die positiven Feed-Backs.
Am Abend war eigentlich ein Konzert angesagt, aber dieses musste aus unbekannten Gründen abgesagt werden. Stattdessen gab es Musik aus der Konserve. Die Stimmung war sehr ausgelassen.
Tag 4 und Abreise
Am nächsten Morgen habe ich mich früh auf den Nachhauseweg gemacht und den letzten Redebeitrag versäumt. Insgesamt fand ich dieses Format sehr reich und inspirierend. Es hat mir wieder einmal richtig Lust gemacht, mich mit KPT zu befassen und auch über die Vielfalt der Methoden und Herangehensweisen zu staunen. Gerne mehr davon.