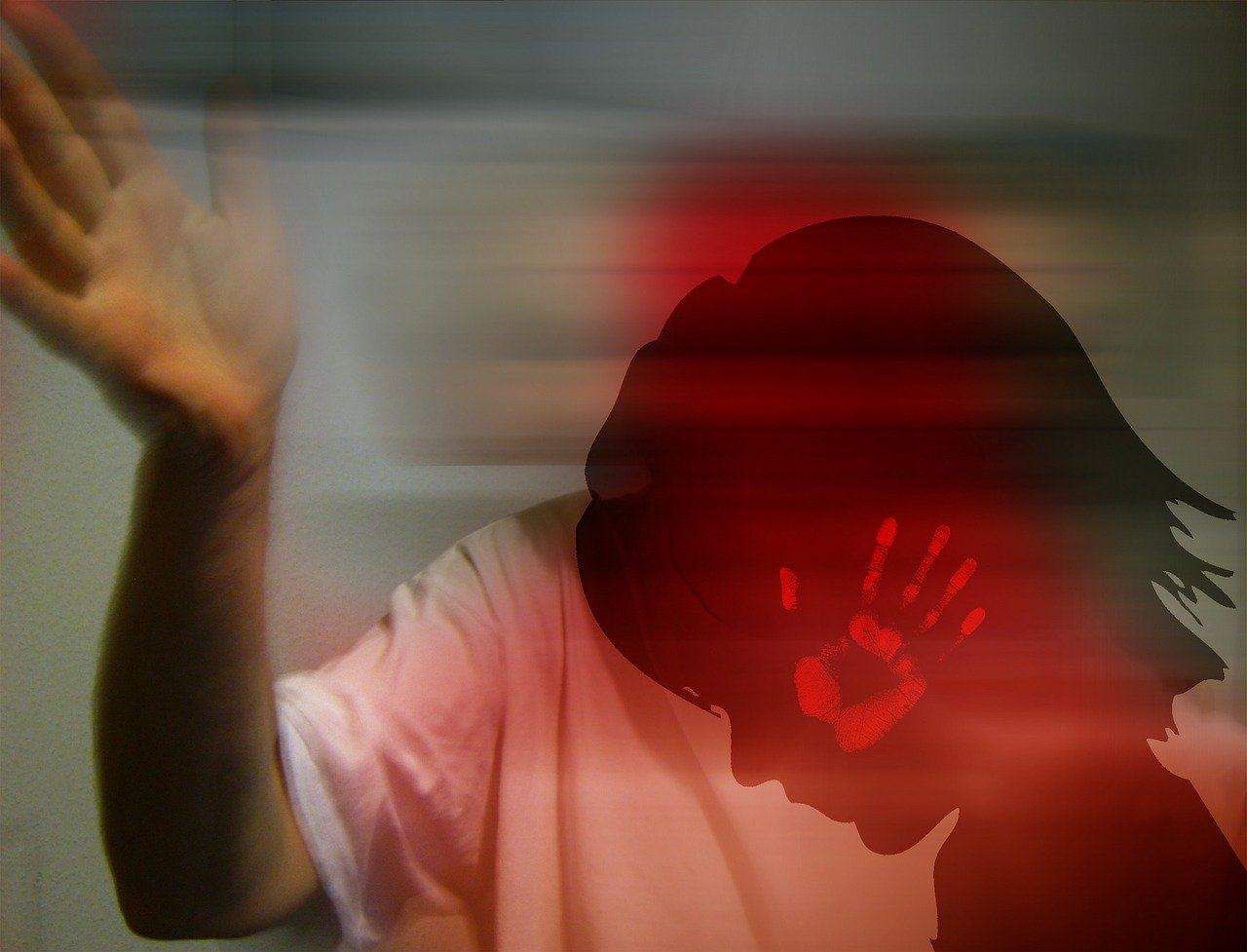Bericht vom Kolloquium „Seele – Körper – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg: Prof. Dr. Tania Lincoln, Universität Hamburg: „Psychotherapie bei Wahnsymptomen. Ist das verrückt?“
Einführung
Frau Lincoln möchte uns die neuesten Entwicklungen für die Psychotherapie von Psychosen vorstellen. Dazu möchte sie uns zunächst aber mit einigen grundlegenden Merkmalen der Psychose vertraut machen und das sind zunächst die Wahnsymptome. Das sind:
„Falsche Überzeugungen, die gewöhnlich mit einer Fehldeutung von Wahrnehmungen oder Erfahrungen einhergeht.“
Als Beispiele wählt sie Beziehungsideen, den Verfolgungswahn und den Größenwahn.
Beziehungswahn bedeutet, dass die Betroffenen Dinge auch sich beziehen, z. B. Zeitungsmeldungen oder auch das Getuschel der Nachbarn. Damit eng verwandt ist der Verfolgungswahn, der die Überzeugung beinhaltet, dass andere mit bösen Absichten hinter einem her seien. Größenwahn beschreibt Vorstellungen, die beinhalten, dass man z. B. Jesus, Napoleon o. ä. sei.
Wahnvorstellungen sind sehr typisch für Psychosen. In 80 % aller Erkrankungen kommen sie vor.
Stand der Dinge
Diesen Abschnitt leitet Frau Lincoln mit dem Brief einer Mutter ein. Darin beklagt die Mutter, dass ihre Tochter seit fünf Jahren stationär untergebracht ist und dass in dieser Zeit kaum eine Psychotherapie stattgefunden habe. Die Begründung dafür lautet, dass eine Psychotherapie erst nach dem Abklingen der Positivsymptome sinnvoll sei.
Diese Ansicht vertreten derzeit noch viele in der Psychiatrie tätige Menschen. Als Beleg dafür weist uns die Referentin einen Wochenplan vor, der für psychiatrische Patienten gerade eine halbe Stunde Gespräch, das nicht unbedingt psychotherapeutisch sein muss, einplant.
Ähnlich schlecht sieht es in der ambulanten Versorgung aus. Zu erwarten wäre ein Anteil von 9 % in den Praxen, tatsächlich macht der Anteil von Betroffenen gerade einmal 2,6 % aus. Sie schließt daraus, dass die Psychotherapie von Psychosen noch keine gängige Praxis im deutschen Versorgungssystem sei. Das führt sie zur Frage, warum das so ist.
Grundannahmen über Wahn
Dazu bekommen wir ein Zitat von Karl Jaspers:
„Bei Symptomen wie Wahn handelt es sich um <<gänzlich fremde erlebniswelten>>. Es ist unmöglich, einen Wahn in seiner Genese zu verstehen.“
Diese Sichtweise herrschte lange vor und kann erklären, warum es kaum Versuche gab, einen psychotherapeutischen Zugang zum Wahnerleben zu erlangen. Wahnerleben scheint außerhalb der allgemeinen psychologischen Theorien zu liegen und damit erscheint es wenig aussichtsreich.
Alltägliche Gedanken
Aber stimmen die Annahmen von Karl Jaspers überhaupt? Ist Wahn tatsächlich gänzlich fremd? Liegen uns paranoide Gedanken tatsächlich so fern? Frau Lincoln lädt und ein, das einmal bei uns selbst zu überprüfen, indem wir uns fragen: Müssen Sie sich davor schützen, von anderen ausgenutzt oder verletzt zu werden? Oder: Entdecken Sie manchmal versteckte Drohungen oder Beleidigungen, in dem, was andere sagen? Ihre Annahme ist, dass vielen Menschen solche Gedanken zumindest ansatzweise vertraut sind. Es gibt dazu auch eine Statistik, die besagt, dass 28,1 % der Bevölkerung Misstrauen kennt, 19 % Beziehungsideen und 9 % Verfolgungsideen.
Gänzlich fremd erscheinen Wahnideen also keinesfalls. Die Thematik lässt sich als Pyramide darstellen. An deren Basis, die viele Menschen umfasst, finden sich Ängste vor Zurückweisung, darüber, weniger Betroffene erfassend, Gedanken über Beziehungsideen, noch höher findet sich ein mildes Bedrohungsgefühl, darüber noch ein moderates Bedrohungsgefühl, das Ausweichmanöver begründet und ganz an der Spitze sind dann die wenigen Menschen, bei denen starke Bedrohungsgefühle bis hin zu Verschwörungstheorien zu finden sind.
Diese Häufigkeit bestärkt die Referentin in der Annahme, dass Wahn nicht so fremd sein kann, wie Jaspers es annahm und weiter, dass Wahn im Spektrum der psychologischen Möglichkeiten liegt und damit auch ein psychotherapeutischer Zugang möglich erscheint.
Kognitive Verhaltenstherapie
Der Grundgedanke der Kognitiven Verhaltenstherapie ist sehr schlicht. Jedes Ereignis führt zu einer Bewertung, die wiederum zu einer Reaktion führt. Wenn ich z. B. mitbekomme, wie meine Nachbarn miteinander tuscheln, könnte ich auf die Bewertung kommen, dass sie über mich tuscheln und das würde mich dann vielleicht dazu bringen, mich in meine Wohnung zurückzuziehen.
Dieser Ansatz hat sich für die Behandlung etlicher Depressionen sehr bewährt. Durch die psychotherapeutische Bearbeitung der Bewertungen kann die Psychotherapie erfolgreich sein. Was lag also näher, als dieses Modell auch auf Wahnsymptome anzuwenden.
Es hat sich dann herausgestellt, dass es doch nicht ganz so einfach ist. In der Behandlung psychotischer Patienten braucht es sehr viel mehr Vorarbeit, bevor man die „kognitive Umstrukturierung“ beginnen kann. Dieser Ansatz wird seit den 90er Jahren verfolgt und wird seither verfeinert. Damals war es quasi eine Sensation und heute gilt er schon als alter Hut, so Frau Lincoln.
Inzwischen gibt es Leitlinien und Manuale zur Behandlung z. B. von Schizophrenie. Deren Wirksamkeit wird natürlich ebenfalls erforscht und diese Forschung ergab, dass die VT kurz- und langfristige Effekte auf die Symptomatik hat. Allerdings schüttet Frau Lincoln gleich ein wenig Wasser in den Wein, denn Follow-Up Studien konnten die ohnehin schwachen Effektstärken nicht immer finden und der Effekt auf das Wahnerleben, war ohnehin sehr gering.
Wahn und Lebensverhältnisse
Das spornt die Vortragende an, nach besseren und wirkungsvolleren Möglichkeiten zu suchen um Psychosen zu behandeln. Also zurück zum zweiten Teil von Jaspers‘ Aussage, dass Wahn unmöglich zu verstehen sei.
Basierend auf der Erfahrung, dass Wahn prinzipiell veränderbar ist, liegt der Gedanke nahe, dass die Lebensverhältnisse eine Rolle bei der Wahnbildung spielen könnten. Wenn man nun noch die psychologischen Mechanismen identifizieren könnte, die von misslichen Lebensumständen zu Wahnvorstellungen führen, dann könnten daraus neue therapeutische Strategie entstehen.
Bekannt ist ebenfalls schon, dass psychotische Episoden häufig getriggert werden. Es gibt also soziale Stressoren, die den Ausbruch einer Wahnepisode begünstigen können.
Ebenfalls gut bekannt sind Risikofaktoren, die eine Erkrankung wahrscheinlicher werden lassen. Zu den Klassikern dieser Faktoren zählen Gen-Defekte und Gehirnschädigungen. Aber diese reichen bei weitem nicht aus, alle Wahnerkrankungen zu erklären, also müssen die sozialen Risikofaktoren unbedingt mitbedacht werden.
Eine Unvollständige Liste sozialer Risikofaktoren umfasst: Traumata, Migration, Mobbing, Diskriminierung, Minderheitenstatus, Geringes Einkommen, Aufwachsen in einer Großstadt … Betrachtet man diese Liste wird deutlich, dass die Betroffenen tatsächlich eine Menge negatives Feedback von ihrer sozialen Umwelt erhalten, also reale Erfahrungen von Zurückweisung bis Feindseligkeit vorhanden sind.
Zusätzliche Faktoren
Eine weitere Erkenntnis besteht darin, dass sich genetische und soziale Risikofaktoren addieren, also unabhängig voneinander wirksam werden können. Hinzu kommen auch noch biografische Vulnerabilitäten, wie z. B. Kindheitstraumen. Diese begünstigen eine psychotische Entwicklung, aber es sind dann immer die aktuellen Stressoren, die zu einem Ausbrauch führen.
Es liegt auf der Hand, dass soziale Stressoren nicht so einfach psychotherapeutisch zum Verschwinden gebracht werden können und dasselbe gilt für die Alltags-Stressoren.
Hier taucht dann die Frage auf, wie denn diese Zusammenhänge vermittelt werden. Wie machen Risikofaktoren jemanden anfällig? Was passiert auf dem Pfad zur Psychose? Wie also hängen Risikofaktoren, Vulnerabilität, Mediatoren mit aktuellen Stressoren und Wahnsymptomen zusammen?
Mechanismen der Wahnentstehung
Zunächst betrachtet Frau Lincoln auf welchen Wegen sich die Vulnerabilität bemerkbar macht bzw. übermittelt. Dazu möchte sie die affektiven, kognitiven und physiologischen Pfade etwas näher untersuchen.
Zu dieser Fragestellung hat sich auch selbst geforscht. Ein zentrales Ergebnis dieser Forschungen ist, dass Menschen aus Risikogruppen sehr ausgeprägt mit Angst reagieren, wenn sie unter Stress geraten. Diese Angst und die damit einhergehende vegetative Erregung sind als Vorläufer Symptome für Psychosen gut bekannt.
Damit ergeben sich neue Hinweise für die spezifische Vulnerabilität, nämlich dass Betroffene häufig Probleme mit der Emotions- und Stressregulation haben, was wiederum ein Hinweis auf belastende Kindheitserfahrungen ist.
Auch der physiologische Weg wurde schon erforscht und das zentrale Ergebnis besagt, dass Betroffen eine geringere Herzratenvariabilität aufweisen. Diese zeigt, wie schnell und vielseitig die Herztätigkeit auf verschiedenen Situationen reagiert. Eine geringe Variabilität findet sich sehr ausgeprägt bei Patienten mit Psychosen.
Emotionsregulation
Schaut man genauer auf die Strategien der Emotionsregulation, findet man bei Betroffenen sehr häufig dysfunktionale Strategien. Sie versuchen, die Gefühle zu unterdrücken oder kommen ins Grübeln und neigen zu Selbstbeschuldigungen. Gesunde Vergleichspersonen nutzen dagegen Ablenkung, Neubewertung oder Akzeptanz um wieder zur Ruhe zu kommen.
Das Gesamtbild
Wir sehen nun das ausgearbeitete Diagramm der Psychose Entstehung. Auf der Basis von genetischen Dispositionen, frühen Hirnschädigungen und sozialen Risikofaktoren stehen nun gestörte Emotions- und Stressregulation, die sich als Übergebrauch ungünstiger Strategien zur Emotionsregulation, sowie als gestörte psychophysiologische Selbstregulation zeigen. Diese begünstigen die Wahnsymptomatik sobald ein aktueller sozialer Stressor auftritt. Damit wären potenzielle therapeutische Ansatzpunkte klarer.
Therapeutische Erfahrungen
Frau Lincoln berichtet uns von einigen Therapie Studien, die auf der Grundlage dieses Modells durchgeführt wurden. Zum einen ging es um Achtsamkeit im Umgang mit Triggern und Sorgen in einem Kurzzeittherapie-Setting. Dies hat sich als gering hilfreich erwiesen.
Der Versuch, mithilfe von Bio-Feedback auf physiologischem Weg Einfluss zu nehmen, war nicht wesentlich erfolgreicher.
Noch mehr Faktoren
Bisher ging die Referentin noch nicht auf den kognitiven Pfad der Wahnentstehung ein, was sie nun nachholt. Kognitiv erfolgen die Bewertungen eines Ereignisses und die Bewertungsschemata entwickeln Menschen z. T. früh im Leben, meist durch die Eltern vermittelt. Es geht um die Art und Weise, sich selbst, die anderen und die Welt zu erleben und zu bewerten.
Hier zeigt die Forschung, dass Betroffene die Welt eher als gefährliche und unberechenbar erleben, sich selbst eher als schwach und wertlos und andere Menschen als stark. Gut erforscht wurde z. B. der negative Effekt von Stress auf den Selbstwert.
Damit wäre ein weiterer therapeutischer Zugang eröffnet – die Arbeit am Selbstwert. Die bisherigen Ergebnisse fallen allerdings auch hier bescheiden aus.
Also bezieht Frau Lincoln nun auch noch das Phänomen der Dopamin Dysregulation ein, denn es ist bekannt, dass dies sehr spezifisch für psychotische Erkrankungen ist. Dopamin Überschuss kann zu verzerrten Wahrnehmungen führen, was einer psychotischen Verarbeitung natürlich zuspielt.
Betroffene nehmen also einen eigentlich harmlosen Reiz bedrohlich wahr, die Angst nimmt relativ unreguliert zu und verunsichert zusätzlich. Nun sucht der Betroffene eine Erklärung für sein Erleben und die wahnhafte Erklärung kann ihm nun ein Gefühl der Erleichterung verschaffen.
Die Rolle des Denkstils
Diese ganze Dynamik wird gestützt und getragen von der Neigung der Betroffenen, schnelle Entscheidungen zu treffen. Diese Art des „schnellen Denkens“ ist gut bekannt bei psychotisch Erkrankten.
Das bringt nun eine neue therapeutische Möglichkeit ins Spiel – die Arbeit mit dem Denkstil. Im Ergebnis scheint es möglich zu sein, den Denkstil tatsächlich zu verlangsamen.
Rückzug und Vermeidungsverhalten
Ein weiteres Merkmal der Erkrankung ist, dass Betroffene sich ungern auf Augenkontakt einlassen. Weiter versuchen sie ihre Ängste mit Vorsorgemaßnahmen einzudämmen z. B. die Tür doppelt abzuschließen o. ä. Dieses Verhalten erleichtert kurzfristig führt aber langfristig immer tiefer in die Ängste.
Hier gab es psychotherapeutische Versuche in virtuellen Umwelten, die durchaus Effekte erzielt haben.
Neue Konzepte
Im Ergebnis gibt es nun eine ganze Reihe von Komponenten, die sich auch alle therapeutisch adressieren lassen, aber jede für sich nur geringe Effektstärke zeigt. Daraus ergibt sich der Gedanke: Könnte man nicht höhere Effektstärken erzielen, wenn alle Komponenten angesprochen würden? Und genau dieser Versuch wurde nun im „Feeling Safe Programm“ verwirklicht.
Es zielt auf Emotionsregulation und Verminderung von Sorgen, sowie auf eine Veränderung des Denkstils sowie das Schlafverhalten und den Umgang mit Stimmen. Das ganze Programm ist modular aufgebaut und kann an die spezifischen Bedürfnisse einzelner Patienten angepasst werden.
Das Programm erzielt tatsächlich relativ hohe Effektstärken und ist inzwischen sehr anerkannt. Wir sehen noch den Werbeclip dazu.
Frau Lincoln schließt, wie sie angefangen hat mit Karl Jaspers. Diesen hat sie mit ihrer Präsentation widerlegt. Symptome von Wahn sind ein Erleben, das tatsächlich verstehbar ist.
Hier geht es zum Vortrag