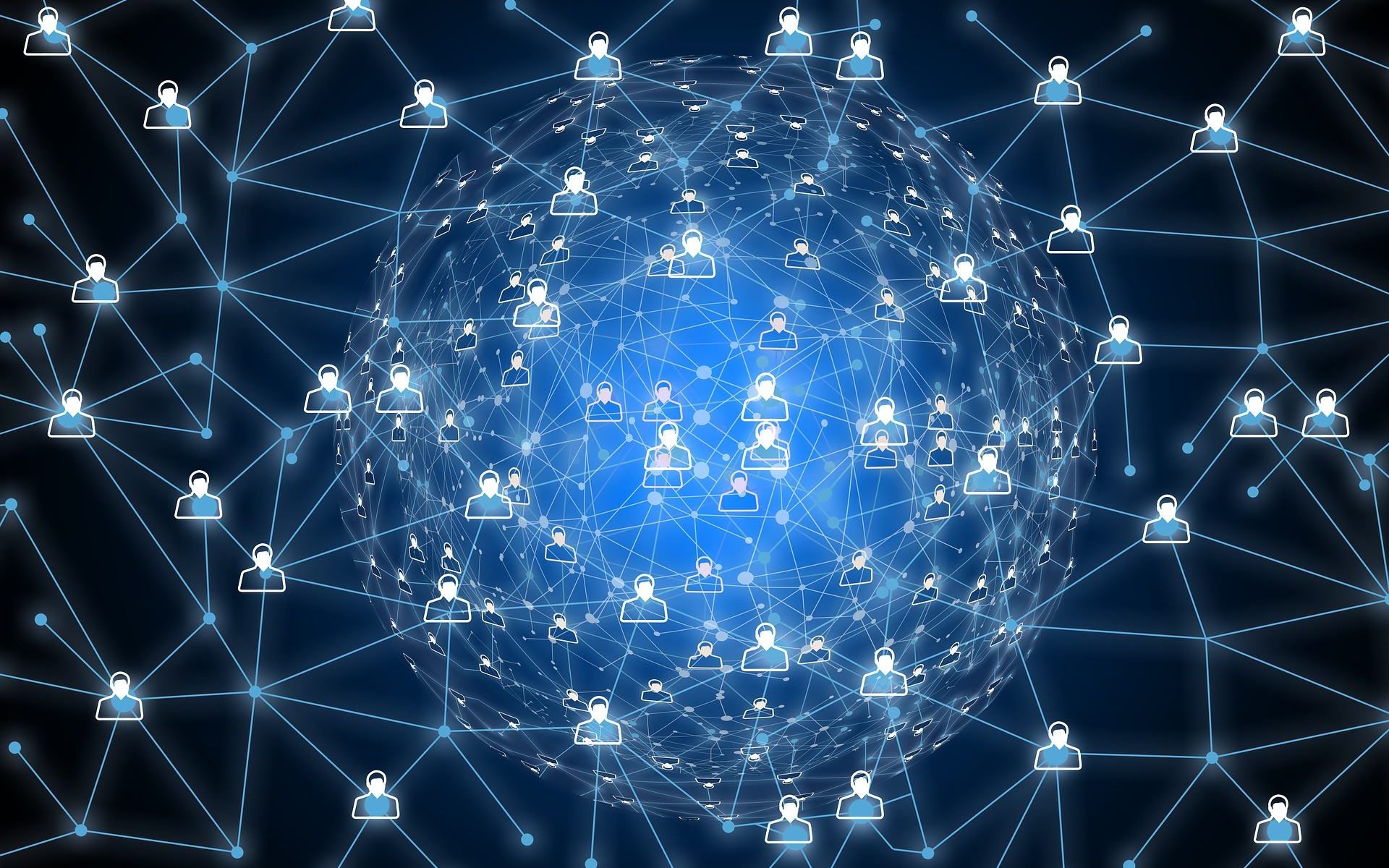Bericht vom Psychosomatischen Dienstags-Kolloquiums „Körper – Seele – Geist“ der Psychosomatischen Klinik Freiburg vom 29.10.19 von Harald Walach, Berlin:
„Spiritualität, Verbundenheit und Psychotherapie“
Erfahrung
Herr Walach stellt uns zu Beginn ein Zitat von John Duns Scotus aus dem fünften Jahrhundert vor: „Wer eine Erfahrung gemacht hat, hat täuschungsfreie Kenntnis“. Mit dieser Definition beginnt er, uns einen Begriffsapparat vorzustellen, der dabei helfen soll, seinen Denkansatz nachzuvollziehen.
In aktueller Sprache formuliert ist Erfahrung:
„Eine kognitiv-affektive Einsicht, die nicht notwendigerweise kategorial einzuordnen ist, aber normalerweise in kategorialem Rahmen ausgedrückt wird, damit sie kommunizierbar wird.“
Hier wird schon deutlich, dass Herr Walach nicht nur Psychologe sondern auch Philosoph ist.
Dass Erfahrungen mehrdeutig sein können, wird durch das Foto eines Papageis veranschaulicht, denn erst bei sehr genauem Hinsehen wird deutlich, dass es sich bei dem Bild um eine kunstvoll bemalte Frau handelt. Eine Erfahrung besteht also aus einer emotional-affektiven und kognitiven Einsicht, der zweitens ein Handlungsimpuls folgt.
Spiritualität
Der nächste Begriff, den Herr Walach definiert, ist „Spiritualität“. Es geht dabei darum, das Leben auf Ziele und Wirklichkeit, über die Belange des eigenen Ichs hinaus, auszurichten.
Spiritualität ist aber auch eine Haltung, die meistens aus einer Erfahrung stammt, einer eigenen Erfahrung oder einer kulturell vermittelten.
Zur Abgrenzung definiert er nun noch „Religion“. Diese ist ein System von Interpretationen bzw. Geschichten, Ritualen und Handlungsschemata, bzw. ethischen Normen. Darin drücken sich spirituelle Erfahrungen aus und haben das eigentliche Ziel, solche Erfahrungen neu zu ermöglichen.
Was ist nun aber eine spirituelle Erfahrung? Es ist die Erfahrung einer absoluten, transzendenten, über das eigene Ich und seine unmittelbaren Belange und Bedürfnisse hinausgehende Wirklichkeit.
Veränderung und Psychotherapie
Das Ziel einer Psychotherapie ist u. a. eine emotional-affektiv getragene kognitive Einsicht in dysfunktionale Verhaltens- und Beziehungsmuster. Sie ermöglicht neue, verändernde Bindungserfahrungen, Erfahrungen von Selbst-Wert und Selbstwirksamkeit, sowie die Einsicht in Abhängigkeiten und missbrauchende Beziehungen und diese Liste ließe sich sicher noch fortsetzen.
Menschen, die von psychischen Problemen betroffen sind, haben häufig die Erfahrung von Vereinzelung und mangelnder Verbundenheit. Ihre Erfahrung ist in der Regel vom jeweiligen Augenblick, der Gegenwart, abgekoppelt. Dabei leben depressive und Suchtkranke Menschen eher in der Vergangenheit. Menschen mit einer Angstthematik eher in der Zukunft, aber beide Gruppen verpassen gewissermaßen die Wirklichkeit der Gegenwart.
Phänomenologie der spirituellen Erfahrung
Anhand weiterer historischer Schriften bringt uns Herr Walach die Merkmale einer spirituellen Erfahrung näher. Dazu nutzt er die Auswertung von unzähligen Berichten aus vielen Kulturen quer durch die Geschichte.
• Einsicht
o Schlagartig „wie ein Blitz“, „Erleuchtung“
o Holistisch-ganzheitlich, die ganze Wirklichkeit betreffend
• Erfahrung von Liebe
o Oft als Liebe Gottes interpretiert, oder als eine liebevolle Zuwendung des Universums
• Erfahrung von Verbundenheit mit Allem: Menschen, Tieren, Natur
o Der Andere, das bin ich“ – „Ich und die Welt sind eins“
• Verlust der Angst vor dem Tod
o Phänomenologisch manchmal Ähnlichkeit mit Nahtoderfahrungen
• Anhaltende Wirkung, tiefgreifende Veränderung der Person
Wie gesagt finden sich diese Erscheinungen durch alle bekannten Zeiten. Dasselbe gilt für das Phänomen, dass diese Erfahrung von außen, also von anderen Menschen, oft nicht verstehbar ist. Betroffene werde als Abweichler erlebt und nicht selten auch als solche behandelt. Das gilt auch noch in der Gegenwart, denn unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten wird diese Erfahrung als „abweichend“ klassifiziert.
Anders, wenn diese Erfahrung im Rahmen eines religiösen Systems gemacht wird. Die Erfahrung wird nun eher religiös oder mystisch genannt, z. B. „Satori“ im Zen Buddhismus oder „Unio mystica“ in christlichen Traditionen.
Spiritualität und Wissenschaft
Ein näherer Blick auf die spirituelle Erfahrung ergibt, dass sie primär die Erfahrung eines subjektiven Bewusstseinsakts ist. Eine Erfahrung von Wirklichkeit von innen heraus. Erst im zweiten Schritt erfolgt nun eine Interpretation, auf der wiederum sozial-politische Institutionalisierungen aufbauen. Diese sorgen für eine Kanonisierung von Schriften und Lehren, die wiederum rekursiv interpretiert und angepasst werden.
Natürlich darf bei einer wissenschaftlichen Betrachtung eine Statistik nicht fehlen. Wir sehen die Ergebnisse einer Umfrage, an der 895 deutschen Psychotherapeuten teilgenommen haben. Immerhin 65 % von ihnen glauben an eine höhere Wirklichkeit. Ein starkes Drittel bezeichnet sich als spirituell und ein Fünftel als religiös. Nach spirituellen Erfahrungen befragt, gibt nur ein gutes Drittel an, noch nie so eine Erfahrung gemacht zu haben. Ein stärkeres Drittel allerdings hat diese Erfahrung sogar als öfter als ein- oder zweimal gemacht. Eine Umfrage aus Neuseeland, Kanada und den USA erbrachte ähnliche Ergebnisse.
Spiritualität und Gesellschaft
Spiritualität scheint also etwas seit langem Bekanntes zu sein, offenbar etwas völlig Normales. Wenn das so ist, stellen sich einige Fragen:
Warum
• gibt es keine „Spiritualitätskolumne in Zeitungen, ähnlich wie „Beziehungskolumnen“?
• ist sie kein öffentliches Thema?
• ist sie gefährlich für akademische Karrieren?
• gibt es darüber so relativ wenig in der wissenschaftlichen Literatur?
• kommt sie in der Psychotherapieausbildung nicht vor?
Herr Walach hat einige Vermutungen dazu:
Weil
• Wissenschaft als Motor und Erbin der Aufklärung oft implizit eine materialistische Weltanschauung transportiert oder impliziert
• die Errungenschaft der Aufklärung, die Trennung von Staat/Öffentlichkeit und Kirche/Religion, als bedeutsam gesehen wird und eine Bedrohung befürchtet wird
• viele Spiritualität und Religion verwechseln
• die Wissenschaft keine Methodik und Systematik der „inneren Erfahrung“ entwickelt hat
• das Metaphysikverbot des Neopositivismus noch fortwirkt
Wissenschaft und Spiritualität – eine historische Betrachtung
Wissenschaft versteht Herr Walach als:
„Ein kollektiver Versuch, die Welt zu verstehen und dabei Irrtum so gut als möglich zu vermeiden.“
Für ein besseres Verständnis betrachtet der Vortragende nun noch die Geschichte der Aufklärung, denn diese ist auch die Geschichte der Wissenschaft. Die Aufklärung hat die Rationalität von der dogmatisch-moralischen Bevormundung und religiöser Kontrolle befreit. Moderne Astronomie statt geo-zentrischer Weltsicht, die Evolutionstheorie, die Psychologie, sowie die Psychoanalyse und die Skepsis. Aber, mit der Religion wurde auch die Spiritualität als Thema verbannt. Gewissermaßen ein „post-hypnotischer Befehl“ des Positivismus.
Daraus hat sich eine Dominanz eines „krypto-materialistischen Weltbilds“ entwickelt. Damit meint Herr Walach, dass der Materialismus eine implizite Voraussetzung des modernen wissenschaftlichen Weltbilds ist. Als sog. „absolute Voraussetzung“ kann der Materialismus aber nicht mehr hinterfragt werden. Er ist notwendig und gleichzeitig begrenzend, aber selbst nicht das Ergebnis eines wissenschaftlichen Diskurses. Diese Sichtweise führte zur Betrachtung des Menschen als Maschine.
So über den Menschen zu denken, lässt sich mindesten bis ins 17te Jahrhundert zurückverfolgen. Der bekannteste Denker und Mitbegründer war sicherlich René Descartes. Seine Sichtweise war in dieser Zeit revolutionär, denn sie war extrem erfolgreich und wurde später auch das neue Paradigma der Biologie. Dann wurde fatalerweise das Maschinen Modell auf den Geist übertragen, der so auch zur Maschine wurde. Und klammheimlich entwickelte sich der Materialismus zur impliziten Ontologie der Wissenschaft.
Spiritualität und Karriere
Mit einer weiteren Statistik verdeutlicht uns Herr Walach diesen Befund. Über neunzig Prozent der Top Wissenschaftler*innen glauben nicht an Gott oder an ein Weiterleben nach dem Tod. Wie kommt es, dass Wissenschaftler so von der obigen Statistik abweichen? Es ist ein „Destillationsprozess“, eine Auslese während der Karriere. Nur wer nicht zu diesen Themen forscht, bzw. Stellung bezieht, bekommt überhaupt eine Chance ein Top Wissenschaftler zu werden. Am Ende (also heute) erscheint es so, als sei Wissenschaft und Atheismus/Agnostizismus identisch und weiter entsteht die Atmosphäre eines impliziten Tabus in der Kultur unserer Gesellschaft.
Neuere Entwicklungen
Aber es scheint sich etwas zu verändern, denn Spiritualität wird mehr und mehr von der Wissenschaft als Thema ernstgenommen.
Neurowissenschaftlich
• Meditation wirkt auf die Struktur des Gehirns ein – es wachsen neue Zellen und neue Synapsen, und das in sehr relevanten Bereichen des Gehirns.
Medizinisch
• Spiritual Care (Palliativmedizin)
• Spiritualität als Ressource (Onkologie)
Medizin-Psychologisch
• Achtsamkeit als großer neuer Forschungszweig
• Achtsamkeitsbasierte Verfahren zur Therapie, als Prävention, zur Selbstfürsorge für Therapeuten und Ärzte
Psychologisch
• Religiöses Coping
• Religionszugehörigkeit als Resilienz Faktor (Gemeinschaft, Lebensführung, Sinnstiftung)
• Sinn und Werte als Resultat religiöser Lebensgestaltung
• Spirituelle Zugänge in der Psychotherapie
Auch zu diesen Themen gibt es bereits Statistiken. Diese zeigen, dass spirituelle Praxis und Erfahrungen die Kraft entfalten, gegen Stress zu wirken. Die Lieblingsstatistik von Herrn Walach nimmt folgendes Setting. Junge Psychotherapeuten (VT) werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe meditiert am Morgen mit einem Zen-Meister, die andere nicht. Alle gehen ihrer Arbeit nach und nach einer gewissen Zeit werden die therapeutischen Erfolge bei den Klienten überprüft. Das Ergebnis lautet: Meditierende Therapeut*innen sind viermal so erfolgreich wie ihre nicht meditierenden Kolleg*innen.
Die Lektion dieser Erkenntnisse lautet also:
„Fehlende spirituelle Praxis ist ein Risikofaktor für die psychische Gesundheit.“
Das erfolgreichste medizinische Verfahren aller Zeiten war die Einführung von Hygiene Vorschriften (ca. 1870), Was wäre, wenn eine ganze Gesellschaft damit anfinge, täglich zu meditieren?
Eine neu/alte Epistemologie
Wie schon aufgezeigt kann die herrschende Erkenntnistheorie die spirituelle Erfahrung nur als „Innenerfahrung“ ohne Wirklichkeitsbezug wahrnehmen. Das war nicht immer so. Bereits die Philosophen Spinoza und Leibniz, aber auch C.G. Jung vertraten ein komplementäres Modell von Materie und Bewusstsein, worin Körper, Materie und Information nur je ein Aspekt einer Einheitswelt sind. Der andere Aspekt ist Geist, Bewusstsein und Bedeutung. Damit ergeben sich zwei Zugänge zur einen Welt, nämlich die Sinneserfahrungen, die wissenschaftlich geprüft werden können und die Innenerfahrungen, die uns mit Sinn, Moral, Werten und evtl. der Tiefenstruktur der Wirklichkeit in Kontakt bringen kann.
Spiritualität und Psychotherapie
Herr Walach fasst zusammen:
• Spiritualität ist eine natürliche Befindlichkeit des Menschen
• Sie repräsentiert die Erfahrung der Verbundenheit
o mit sich selbst
o zu anderen
o zur Welt
• Stellt daher eine Ressource dar
o Für Psychotherapeut*innen
o Und Patient*innen
Praktisch bedeutet das:
• Die Forderung nach einer Kultur und einer Kultivierung des Bewusstseins als praktische Konsequenz
o Regelmäßige Aus-Zeit (Meditation, Sammlung, Kontemplation, Yoga … )
• Für Therapeut*innen und Patient*innen
• Die erleichtert den Zugang zu Sinnerfahrungen und Rekonstruktionen des Lebens.
Viel Beifall für diesen reichen Vortrag.